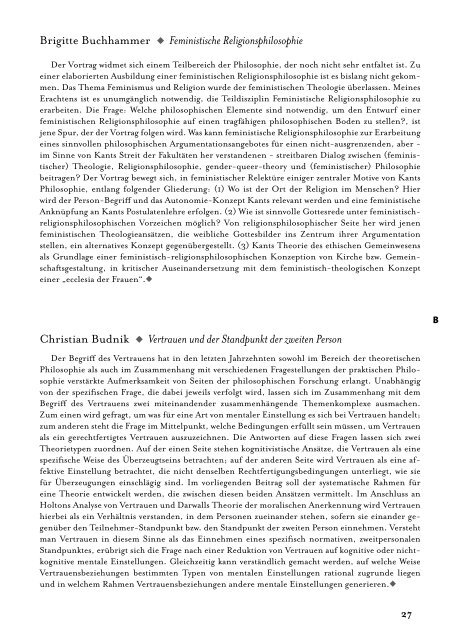Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Brigitte Buchhammer ◆ Feministische Religionsphilosophie<br />
Der Vortrag widmet sich einem Teilbereich der Philosophie, der noch nicht sehr entfaltet ist. Zu<br />
einer elaborierten Ausbildung einer feministischen Religionsphilosophie ist es bislang nicht gekommen.<br />
Das Thema Feminismus und Religion wurde der feministischen Theologie überlassen. Meines<br />
Erachtens ist es unumgänglich notwendig, die Teildisziplin Feministische Religionsphilosophie zu<br />
erarbeiten. Die Frage: Welche philosophischen Elemente sind notwendig, um den Entwurf einer<br />
feministischen Religionsphilosophie auf einen tragfähigen philosophischen Boden zu stellen?, ist<br />
jene Spur, der der Vortrag folgen wird. Was kann feministische Religionsphilosophie zur Erarbeitung<br />
eines sinnvollen philosophischen Argumentationsangebotes <strong>für</strong> einen nicht-ausgrenzenden, aber -<br />
im Sinne von Kants Streit der Fakultäten her verstandenen - streitbaren Dialog zwischen (feministischer)<br />
Theologie, Religionsphilosophie, gender-queer-theory und (feministischer) Philosophie<br />
beitragen? Der Vortrag bewegt sich, in feministischer Relektüre einiger zentraler Motive von Kants<br />
Philosophie, entlang folgender Gliederung: (1) Wo ist der Ort der Religion im Menschen? Hier<br />
wird der Person-Begriff und das Autonomie-Konzept Kants relevant werden und eine feministische<br />
Anknüpfung an Kants Postulatenlehre erfolgen. (2) Wie ist sinnvolle Gottesrede unter feministischreligionsphilosophischen<br />
Vorzeichen möglich? Von religionsphilosophischer Seite her wird jenen<br />
feministischen Theologieansätzen, die weibliche Gottesbilder ins Zentrum ihrer Argumentation<br />
stellen, ein alternatives Konzept gegenübergestellt. (3) Kants Theorie des ethischen Gemeinwesens<br />
als Grundlage einer feministisch-religionsphilosophischen Konzeption von Kirche bzw. Gemeinschaftsgestaltung,<br />
in kritischer Auseinandersetzung mit dem feministisch-theologischen Konzept<br />
einer „ecclesia der Frauen“.◆<br />
Christian Budnik ◆ Vertrauen und der Standpunkt der zweiten Person<br />
Der Begriff des Vertrauens hat in den letzten Jahrzehnten sowohl im Bereich der theoretischen<br />
Philosophie als auch im Zusammenhang mit verschiedenen Fragestellungen der praktischen Philosophie<br />
verstärkte Aufmerksamkeit von Seiten der philosophischen Forschung erlangt. Unabhängig<br />
von der spezifischen Frage, die dabei jeweils verfolgt wird, lassen sich im Zusammenhang mit dem<br />
Begriff des Vertrauens zwei miteinandender zusammenhängende Themenkomplexe ausmachen.<br />
Zum einen wird gefragt, um was <strong>für</strong> eine Art von mentaler Einstellung es sich bei Vertrauen handelt;<br />
zum anderen steht die Frage im Mittelpunkt, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um Vertrauen<br />
als ein gerechtfertigtes Vertrauen auszuzeichnen. Die Antworten auf diese Fragen lassen sich zwei<br />
Theorietypen zuordnen. Auf der einen Seite stehen kognitivistische Ansätze, die Vertrauen als eine<br />
spezifische Weise des Überzeugtseins betrachten; auf der anderen Seite wird Vertrauen als eine affektive<br />
Einstellung betrachtet, die nicht denselben Rechtfertigungsbedingungen unterliegt, wie sie<br />
<strong>für</strong> Überzeugungen einschlägig sind. Im vorliegenden Beitrag soll der systematische Rahmen <strong>für</strong><br />
eine Theorie entwickelt werden, die zwischen diesen beiden Ansätzen vermittelt. Im Anschluss an<br />
Holtons Analyse von Vertrauen und Darwalls Theorie der moralischen Anerkennung wird Vertrauen<br />
hierbei als ein Verhältnis verstanden, in dem Personen zueinander stehen, sofern sie einander gegenüber<br />
den Teilnehmer-Standpunkt bzw. den Standpunkt der zweiten Person einnehmen. Versteht<br />
man Vertrauen in diesem Sinne als das Einnehmen eines spezifisch normativen, zweitpersonalen<br />
Standpunktes, erübrigt sich die Frage nach einer Reduktion von Vertrauen auf kognitive oder nichtkognitive<br />
mentale Einstellungen. Gleichzeitig kann verständlich gemacht werden, auf welche Weise<br />
Vertrauensbeziehungen bestimmten Typen von mentalen Einstellungen rational zugrunde liegen<br />
und in welchem Rahmen Vertrauensbeziehungen andere mentale Einstellungen generieren.◆<br />
27<br />
B