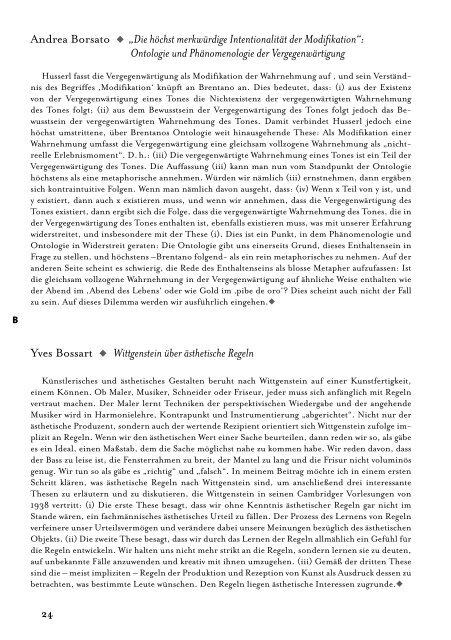Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
B<br />
Andrea Borsato ◆ „Die höchst merkwürdige Intentionalität der Modifikation“:<br />
Ontologie und Phänomenologie der Vergegenwärtigung<br />
Husserl fasst die Vergegenwärtigung als Modifikation der Wahrnehmung auf , und sein Verständnis<br />
des Begriffes ‚Modifikation‘ knüpft an Brentano an. Dies bedeutet, dass: (i) aus der Existenz<br />
von der Vergegenwärtigung eines Tones die Nichtexistenz der vergegenwärtigten Wahrnehmung<br />
des Tones folgt; (ii) aus dem Bewusstsein der Vergegenwärtigung des Tones folgt jedoch das Bewusstsein<br />
der vergegenwärtigten Wahrnehmung des Tones. Damit verbindet Husserl jedoch eine<br />
höchst umstrittene, über Brentanos Ontologie weit hinausgehende These: Als Modifikation einer<br />
Wahrnehmung umfasst die Vergegenwärtigung eine gleichsam vollzogene Wahrnehmung als „nichtreelle<br />
Erlebnismoment“. D. h.: (iii) Die vergegenwärtigte Wahrnehmung eines Tones ist ein Teil der<br />
Vergegenwärtigung des Tones. Die Auffassung (iii) kann man nun vom Standpunkt der Ontologie<br />
höchstens als eine metaphorische annehmen. Würden wir nämlich (iii) ernstnehmen, dann ergäben<br />
sich kontraintuitive Folgen. Wenn man nämlich davon ausgeht, dass: (iv) Wenn x Teil von y ist, und<br />
y existiert, dann auch x existieren muss, und wenn wir annehmen, dass die Vergegenwärtigung des<br />
Tones existiert, dann ergibt sich die Folge, dass die vergegenwärtigte Wahrnehmung des Tones, die in<br />
der Vergegenwärtigung des Tones enthalten ist, ebenfalls existieren muss, was mit unserer Erfahrung<br />
widerstreitet, und insbesondere mit der These (i). Dies ist ein Punkt, in dem Phänomenologie und<br />
Ontologie in Widerstreit geraten: Die Ontologie gibt uns einerseits Grund, dieses Enthaltensein in<br />
Frage zu stellen, und höchstens –Brentano folgend- als ein rein metaphorisches zu nehmen. Auf der<br />
anderen Seite scheint es schwierig, die Rede des Enthaltenseins als blosse Metapher aufzufassen: Ist<br />
die gleichsam vollzogene Wahrnehmung in der Vergegenwärtigung auf ähnliche Weise enthalten wie<br />
der Abend im ‚Abend des Lebens‘ oder wie Gold im ‚pibe de oro‘? Dies scheint auch nicht der Fall<br />
zu sein. Auf dieses Dilemma werden wir ausführlich eingehen.◆<br />
Yves Bossart ◆ Wittgenstein über ästhetische Regeln<br />
Künstlerisches und ästhetisches Gestalten beruht nach Wittgenstein auf einer Kunstfertigkeit,<br />
einem Können. Ob Maler, Musiker, Schneider oder Friseur, jeder muss sich anfänglich mit Regeln<br />
vertraut machen. Der Maler lernt Techniken der perspektivischen Wiedergabe und der angehende<br />
Musiker wird in Harmonielehre, Kontrapunkt und Instrumentierung „abgerichtet“. Nicht nur der<br />
ästhetische Produzent, sondern auch der wertende Rezipient orientiert sich Wittgenstein zufolge implizit<br />
an Regeln. Wenn wir den ästhetischen Wert einer Sache beurteilen, dann reden wir so, als gäbe<br />
es ein Ideal, einen Maßstab, dem die Sache möglichst nahe zu kommen habe. Wir reden davon, dass<br />
der Bass zu leise ist, die Fensterrahmen zu breit, der Mantel zu lang und die Frisur nicht voluminös<br />
genug. Wir tun so als gäbe es „richtig“ und „falsch“. In meinem Beitrag möchte ich in einem ersten<br />
Schritt klären, was ästhetische Regeln nach Wittgenstein sind, um anschließend drei interessante<br />
Thesen zu erläutern und zu diskutieren, die Wittgenstein in seinen Cambridger Vorlesungen von<br />
1938 vertritt: (i) Die erste These besagt, dass wir ohne Kenntnis ästhetischer Regeln gar nicht im<br />
Stande wären, ein fachmännisches ästhetisches Urteil zu fällen. Der Prozess des Lernens von Regeln<br />
verfeinere unser Urteilsvermögen und verändere dabei unsere Meinungen bezüglich des ästhetischen<br />
Objekts. (ii) Die zweite These besagt, dass wir durch das Lernen der Regeln allmählich ein Gefühl <strong>für</strong><br />
die Regeln entwickeln. Wir halten uns nicht mehr strikt an die Regeln, sondern lernen sie zu deuten,<br />
auf unbekannte Fälle anzuwenden und kreativ mit ihnen umzugehen. (iii) Gemäß der dritten These<br />
sind die – meist impliziten – Regeln der Produktion und Rezeption von Kunst als Ausdruck dessen zu<br />
betrachten, was bestimmte Leute wünschen. Den Regeln liegen ästhetische Interessen zugrunde.◆<br />
24