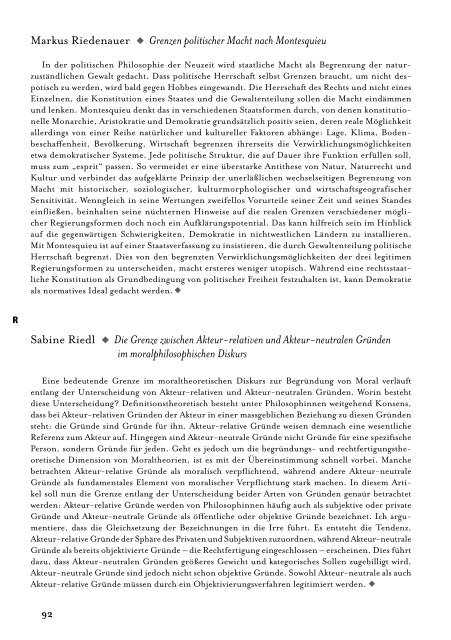Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
R<br />
Markus Riedenauer ◆ Grenzen politischer Macht nach Montesquieu<br />
In der politischen Philosophie der Neuzeit wird staatliche Macht als Begrenzung der naturzuständlichen<br />
Gewalt gedacht. Dass politische Herrschaft selbst Grenzen braucht, um nicht despotisch<br />
zu werden, wird bald gegen Hobbes eingewandt. Die Herrschaft des Rechts und nicht eines<br />
Einzelnen, die Konstitution eines Staates und die Gewaltenteilung sollen die Macht eindämmen<br />
und lenken. Montesquieu denkt das in verschiedenen Staatsformen durch, von denen konstitutionelle<br />
Monarchie, Aristokratie und Demokratie grundsätzlich positiv seien, deren reale Möglichkeit<br />
allerdings von einer Reihe natürlicher und kultureller Faktoren abhänge: Lage, Klima, Bodenbeschaffenheit,<br />
Bevölkerung, Wirtschaft begrenzen ihrerseits die Verwirklichungsmöglichkeiten<br />
etwa demokratischer Systeme. Jede politische Struktur, die auf Dauer ihre Funktion erfüllen soll,<br />
muss zum „esprit“ passen. So vermeidet er eine überstarke Antithese von Natur, Naturrecht und<br />
Kultur und verbindet das aufgeklärte Prinzip der unerläßlichen wechselseitigen Begrenzung von<br />
Macht mit historischer, soziologischer, kulturmorphologischer und wirtschaftsgeografischer<br />
Sensitivität. Wenngleich in seine Wertungen zweifellos Vorurteile seiner Zeit und seines Standes<br />
einfließen, beinhalten seine nüchternen Hinweise auf die realen Grenzen verschiedener möglicher<br />
Regierungsformen doch noch ein Aufklärungspotential. Das kann hilfreich sein im Hinblick<br />
auf die gegenwärtigen Schwierigkeiten, Demokratie in nichtwestlichen Ländern zu installieren.<br />
Mit Montesquieu ist auf einer Staatsverfassung zu insistieren, die durch Gewaltenteilung politische<br />
Herrschaft begrenzt. Dies von den begrenzten Verwirklichungsmöglichkeiten der drei legitimen<br />
Regierungsformen zu unterscheiden, macht ersteres weniger utopisch. Während eine rechtsstaatliche<br />
Konstitution als Grundbedingung von politischer Freiheit festzuhalten ist, kann Demokratie<br />
als normatives Ideal gedacht werden. ◆<br />
Sabine Riedl ◆ Die Grenze zwischen Akteur-relativen und Akteur-neutralen Gründen<br />
im moralphilosophischen Diskurs<br />
Eine bedeutende Grenze im moraltheoretischen Diskurs zur Begründung von Moral verläuft<br />
entlang der Unterscheidung von Akteur-relativen und Akteur-neutralen Gründen. Worin besteht<br />
diese Unterscheidung? Definitionstheoretisch besteht unter Philosophinnen weitgehend Konsens,<br />
dass bei Akteur-relativen Gründen der Akteur in einer massgeblichen Beziehung zu diesen Gründen<br />
steht: die Gründe sind Gründe <strong>für</strong> ihn. Akteur-relative Gründe weisen demnach eine wesentliche<br />
Referenz zum Akteur auf. Hingegen sind Akteur-neutrale Gründe nicht Gründe <strong>für</strong> eine spezifische<br />
Person, sondern Gründe <strong>für</strong> jeden. Geht es jedoch um die begründungs- und rechtfertigungstheoretische<br />
Dimension von Moraltheorien, ist es mit der Übereinstimmung schnell vorbei. Manche<br />
betrachten Akteur-relative Gründe als moralisch verpflichtend, während andere Akteur-neutrale<br />
Gründe als fundamentales Element von moralischer Verpflichtung stark machen. In diesem Artikel<br />
soll nun die Grenze entlang der Unterscheidung beider Arten von Gründen genaür betrachtet<br />
werden: Akteur-relative Gründe werden von Philosophinnen häufig auch als subjektive oder private<br />
Gründe und Akteur-neutrale Gründe als öffentliche oder objektive Gründe bezeichnet. Ich argumentiere,<br />
dass die Gleichsetzung der Bezeichnungen in die Irre führt. Es entsteht die Tendenz,<br />
Akteur-relative Gründe der Sphäre des Privaten und Subjektiven zuzuordnen, während Akteur-neutrale<br />
Gründe als bereits objektivierte Gründe – die Rechtfertigung eingeschlossen – erscheinen. Dies führt<br />
dazu, dass Akteur-neutralen Gründen größeres Gewicht und kategorisches Sollen zugebilligt wird.<br />
Akteur-neutrale Gründe sind jedoch nicht schon objektive Gründe. Sowohl Akteur-neutrale als auch<br />
Akteur-relative Gründe müssen durch ein Objektivierungsverfahren legitimiert werden. ◆<br />
92