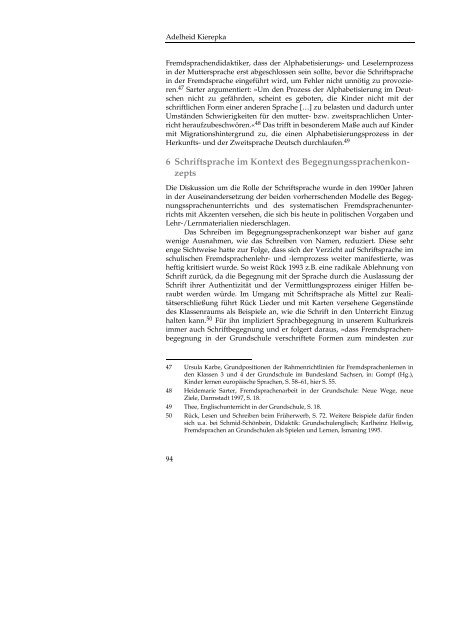Oder: Welchen Mehrwert hat die Mehrsprachig - IMIS - Universität ...
Oder: Welchen Mehrwert hat die Mehrsprachig - IMIS - Universität ...
Oder: Welchen Mehrwert hat die Mehrsprachig - IMIS - Universität ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Adelheid Kierepka<br />
Fremdsprachendidaktiker, dass der Alphabetisierungs- und Leselernprozess<br />
in der Muttersprache erst abgeschlossen sein sollte, bevor <strong>die</strong> Schriftsprache<br />
in der Fremdsprache eingeführt wird, um Fehler nicht unnötig zu provozieren.<br />
47 Sarter argumentiert: »Um den Prozess der Alphabetisierung im Deutschen<br />
nicht zu gefährden, scheint es geboten, <strong>die</strong> Kinder nicht mit der<br />
schriftlichen Form einer anderen Sprache […] zu belasten und dadurch unter<br />
Umständen Schwierigkeiten für den mutter- bzw. zweitsprachlichen Unterricht<br />
heraufzubeschwören.« 48 Das trifft in besonderem Maße auch auf Kinder<br />
mit Migrationshintergrund zu, <strong>die</strong> einen Alphabetisierungsprozess in der<br />
Herkunfts- und der Zweitsprache Deutsch durchlaufen. 49<br />
6 Schriftsprache im Kontext des Begegnungssprachenkonzepts<br />
Die Diskussion um <strong>die</strong> Rolle der Schriftsprache wurde in den 1990er Jahren<br />
in der Auseinandersetzung der beiden vorherrschenden Modelle des Begegnungssprachenunterrichts<br />
und des systematischen Fremdsprachenunterrichts<br />
mit Akzenten versehen, <strong>die</strong> sich bis heute in politischen Vorgaben und<br />
Lehr-/Lernmaterialien niederschlagen.<br />
Das Schreiben im Begegnungssprachenkonzept war bisher auf ganz<br />
wenige Ausnahmen, wie das Schreiben von Namen, reduziert. Diese sehr<br />
enge Sichtweise <strong>hat</strong>te zur Folge, dass sich der Verzicht auf Schriftsprache im<br />
schulischen Fremdsprachenlehr- und -lernprozess weiter manifestierte, was<br />
heftig kritisiert wurde. So weist Rück 1993 z.B. eine radikale Ablehnung von<br />
Schrift zurück, da <strong>die</strong> Begegnung mit der Sprache durch <strong>die</strong> Auslassung der<br />
Schrift ihrer Authentizität und der Vermittlungsprozess einiger Hilfen beraubt<br />
werden würde. Im Umgang mit Schriftsprache als Mittel zur Realitätserschließung<br />
führt Rück Lieder und mit Karten versehene Gegenstände<br />
des Klassenraums als Beispiele an, wie <strong>die</strong> Schrift in den Unterricht Einzug<br />
halten kann. 50 Für ihn impliziert Sprachbegegnung in unserem Kulturkreis<br />
immer auch Schriftbegegnung und er folgert daraus, »dass Fremdsprachenbegegnung<br />
in der Grundschule verschriftete Formen zum mindesten zur<br />
47 Ursula Karbe, Grundpositionen der Rahmenrichtlinien für Fremdsprachenlernen in<br />
den Klassen 3 und 4 der Grundschule im Bundesland Sachsen, in: Gompf (Hg.),<br />
Kinder lernen europäische Sprachen, S. 58–61, hier S. 55.<br />
48 Heidemarie Sarter, Fremdsprachenarbeit in der Grundschule: Neue Wege, neue<br />
Ziele, Darmstadt 1997, S. 18.<br />
49 Thee, Englischunterricht in der Grundschule, S. 18.<br />
50 Rück, Lesen und Schreiben beim Früherwerb, S. 72. Weitere Beispiele dafür finden<br />
sich u.a. bei Schmid-Schönbein, Didaktik: Grundschulenglisch; Karlheinz Hellwig,<br />
Fremdsprachen an Grundschulen als Spielen und Lernen, Ismaning 1995.<br />
94