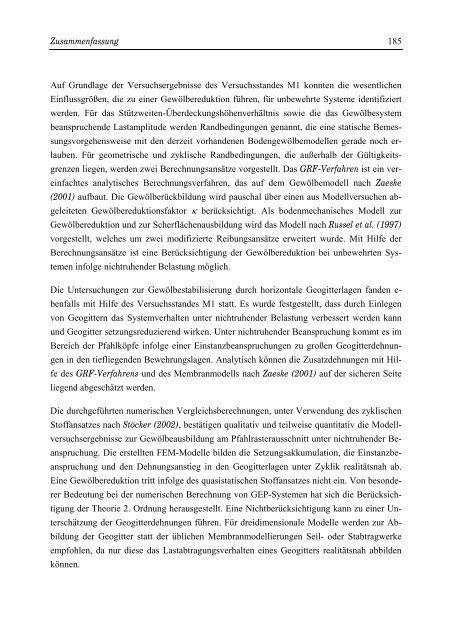Bodengewölbe unter ruhender und nichtruhender Belastung bei ...
Bodengewölbe unter ruhender und nichtruhender Belastung bei ...
Bodengewölbe unter ruhender und nichtruhender Belastung bei ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Zusammenfassung 185<br />
Auf Gr<strong>und</strong>lage der Versuchsergebnisse des Versuchsstandes M1 konnten die wesentlichen<br />
Einflussgrößen, die zu einer Gewölbereduktion führen, für unbewehrte Systeme identifiziert<br />
werden. Für das Stützweiten-Überdeckungshöhenverhältnis sowie die das Gewölbesystem<br />
beanspruchende Lastamplitude werden Randbedingungen genannt, die eine statische Bemessungsvorgehensweise<br />
mit den derzeit vorhandenen <strong>Bodengewölbe</strong>modellen gerade noch erlauben.<br />
Für geometrische <strong>und</strong> zyklische Randbedingungen, die außerhalb der Gültigkeitsgrenzen<br />
liegen, werden zwei Berechnungsansätze vorgestellt. Das GRF-Verfahren ist ein vereinfachtes<br />
analytisches Berechnungsverfahren, das auf dem Gewölbemodell nach Zaeske<br />
(2001) aufbaut. Die Gewölberückbildung wird pauschal über einen aus Modellversuchen abgeleiteten<br />
Gewölbereduktionsfaktor κ berücksichtigt. Als bodenmechanisches Modell zur<br />
Gewölbereduktion <strong>und</strong> zur Scherflächenausbildung wird das Modell nach Russel et al. (1997)<br />
vorgestellt, welches um zwei modifizierte Reibungsansätze erweitert wurde. Mit Hilfe der<br />
Berechnungsansätze ist eine Berücksichtigung der Gewölbereduktion <strong>bei</strong> unbewehrten Systemen<br />
infolge nicht<strong>ruhender</strong> <strong>Belastung</strong> möglich.<br />
Die Untersuchungen zur Gewölbestabilisierung durch horizontale Geogitterlagen fanden e-<br />
benfalls mit Hilfe des Versuchsstandes M1 statt. Es wurde festgestellt, dass durch Einlegen<br />
von Geogittern das Systemverhalten <strong>unter</strong> nicht<strong>ruhender</strong> <strong>Belastung</strong> verbessert werden kann<br />
<strong>und</strong> Geogitter setzungsreduzierend wirken. Unter nicht<strong>ruhender</strong> Beanspruchung kommt es im<br />
Bereich der Pfahlköpfe infolge einer Einstanzbeanspruchungen zu großen Geogitterdehnungen<br />
in den tiefliegenden Bewehrungslagen. Analytisch können die Zusatzdehnungen mit Hilfe<br />
des GRF-Verfahrens <strong>und</strong> des Membranmodells nach Zaeske (2001) auf der sicheren Seite<br />
liegend abgeschätzt werden.<br />
Die durchgeführten numerischen Vergleichsberechnungen, <strong>unter</strong> Verwendung des zyklischen<br />
Stoffansatzes nach Stöcker (2002), bestätigen qualitativ <strong>und</strong> teilweise quantitativ die Modellversuchsergebnisse<br />
zur Gewölbeausbildung am Pfahlrasterausschnitt <strong>unter</strong> nicht<strong>ruhender</strong> Beanspruchung.<br />
Die erstellten FEM-Modelle bilden die Setzungsakkumulation, die Einstanzbeanspruchung<br />
<strong>und</strong> den Dehnungsanstieg in den Geogitterlagen <strong>unter</strong> Zyklik realitätsnah ab.<br />
Eine Gewölbereduktion tritt infolge des quasistatischen Stoffansatzes nicht ein. Von besonderer<br />
Bedeutung <strong>bei</strong> der numerischen Berechnung von GEP-Systemen hat sich die Berücksichtigung<br />
der Theorie 2. Ordnung herausgestellt. Eine Nichtberücksichtigung kann zu einer Unterschätzung<br />
der Geogitterdehnungen führen. Für dreidimensionale Modelle werden zur Abbildung<br />
der Geogitter statt der üblichen Membranmodellierungen Seil- oder Stabtragwerke<br />
empfohlen, da nur diese das Lastabtragungsverhalten eines Geogitters realitätsnah abbilden<br />
können.