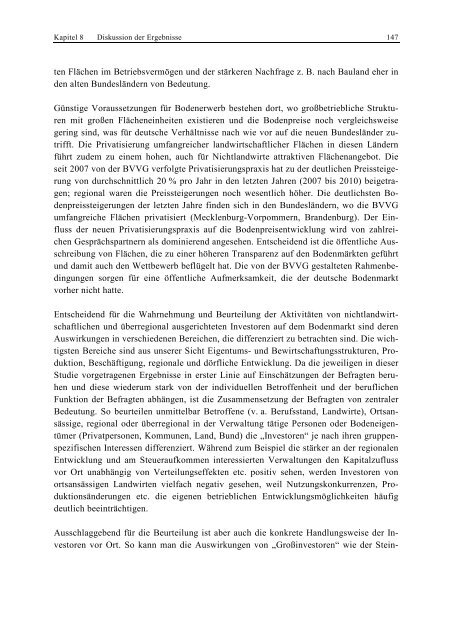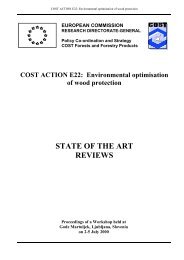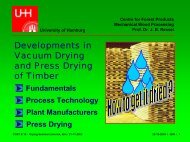352 - 1. Januar 2008
352 - 1. Januar 2008
352 - 1. Januar 2008
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kapitel 8 Diskussion der Ergebnisse 147<br />
ten Flächen im Betriebsvermögen und der stärkeren Nachfrage z. B. nach Bauland eher in<br />
den alten Bundesländern von Bedeutung.<br />
Günstige Voraussetzungen für Bodenerwerb bestehen dort, wo großbetriebliche Strukturen<br />
mit großen Flächeneinheiten existieren und die Bodenpreise noch vergleichsweise<br />
gering sind, was für deutsche Verhältnisse nach wie vor auf die neuen Bundesländer zutrifft.<br />
Die Privatisierung umfangreicher landwirtschaftlicher Flächen in diesen Ländern<br />
führt zudem zu einem hohen, auch für Nichtlandwirte attraktiven Flächenangebot. Die<br />
seit 2007 von der BVVG verfolgte Privatisierungspraxis hat zu der deutlichen Preissteigerung<br />
von durchschnittlich 20 % pro Jahr in den letzten Jahren (2007 bis 2010) beigetragen;<br />
regional waren die Preissteigerungen noch wesentlich höher. Die deutlichsten Bodenpreissteigerungen<br />
der letzten Jahre finden sich in den Bundesländern, wo die BVVG<br />
umfangreiche Flächen privatisiert (Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg). Der Einfluss<br />
der neuen Privatisierungspraxis auf die Bodenpreisentwicklung wird von zahlreichen<br />
Gesprächspartnern als dominierend angesehen. Entscheidend ist die öffentliche Ausschreibung<br />
von Flächen, die zu einer höheren Transparenz auf den Bodenmärkten geführt<br />
und damit auch den Wettbewerb beflügelt hat. Die von der BVVG gestalteten Rahmenbedingungen<br />
sorgen für eine öffentliche Aufmerksamkeit, die der deutsche Bodenmarkt<br />
vorher nicht hatte.<br />
Entscheidend für die Wahrnehmung und Beurteilung der Aktivitäten von nichtlandwirtschaftlichen<br />
und überregional ausgerichteten Investoren auf dem Bodenmarkt sind deren<br />
Auswirkungen in verschiedenen Bereichen, die differenziert zu betrachten sind. Die wichtigsten<br />
Bereiche sind aus unserer Sicht Eigentums- und Bewirtschaftungsstrukturen, Produktion,<br />
Beschäftigung, regionale und dörfliche Entwicklung. Da die jeweiligen in dieser<br />
Studie vorgetragenen Ergebnisse in erster Linie auf Einschätzungen der Befragten beruhen<br />
und diese wiederum stark von der individuellen Betroffenheit und der beruflichen<br />
Funktion der Befragten abhängen, ist die Zusammensetzung der Befragten von zentraler<br />
Bedeutung. So beurteilen unmittelbar Betroffene (v. a. Berufsstand, Landwirte), Ortsansässige,<br />
regional oder überregional in der Verwaltung tätige Personen oder Bodeneigentümer<br />
(Privatpersonen, Kommunen, Land, Bund) die „Investoren“ je nach ihren gruppenspezifischen<br />
Interessen differenziert. Während zum Beispiel die stärker an der regionalen<br />
Entwicklung und am Steueraufkommen interessierten Verwaltungen den Kapitalzufluss<br />
vor Ort unabhängig von Verteilungseffekten etc. positiv sehen, werden Investoren von<br />
ortsansässigen Landwirten vielfach negativ gesehen, weil Nutzungskonkurrenzen, Produktionsänderungen<br />
etc. die eigenen betrieblichen Entwicklungsmöglichkeiten häufig<br />
deutlich beeinträchtigen.<br />
Ausschlaggebend für die Beurteilung ist aber auch die konkrete Handlungsweise der Investoren<br />
vor Ort. So kann man die Auswirkungen von „Großinvestoren“ wie der Stein-