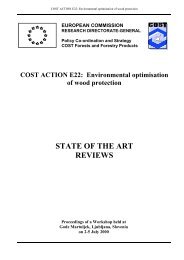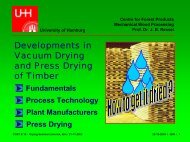352 - 1. Januar 2008
352 - 1. Januar 2008
352 - 1. Januar 2008
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kapitel 4 Rahmenbedingungen für nichtlandwirtschaftliche und überregional ausgerichtete … 25<br />
tragsparteien aber frei sein, sich zum Erreichen ihres Zieles der vertraglichen Ausgestaltungsmöglichkeiten<br />
des BGB zu bedienen. Zu beachten ist nach König auch, dass ein<br />
Eingriff in die Veräußerungsfreiheit des Grundvermögens einen erheblichen Eingriff in<br />
das Grundrecht aus Art. 14 GG darstellt.<br />
4.2 Privatisierung der ehemals volkseigenen Flächen<br />
Bei der Privatisierung von im Zeitraum 1945 bis 1949 in der sowjetischen Besatzungszone<br />
enteigneten Flächen ging es nach weitgehender Klärung der Eigentumsverhältnisse um<br />
etwa <strong>1.</strong>100.000 ha landwirtschaftliche Fläche, wobei der Großteil in Mecklenburg-<br />
Vorpommern (rund 39 %), Brandenburg (rund 28 %) und in Sachsen-Anhalt (rund 17 %)<br />
lag (KLAGES, 2001). Die Privatisierung dieser ehemals volkseigenen Flächen soll nach § 1<br />
Abs. 6 Treuhandgesetz (THG, GBl I. 1990, S. 300) so gestaltet werden, dass „den ökonomischen,<br />
ökologischen, strukturellen und eigentumsrechtlichen Besonderheiten“ in der<br />
Land- und Forstwirtschaft Rechnung getragen wird. Die Privatisierung ist auch fiskalpolitischen<br />
Zielen unterworfen, insbesondere der Wahrung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit,<br />
d. h. dem Barwert des Überschusses der Verwertungserlöse über die Verwaltungs-<br />
und Verwertungskosten. Zunächst dominierten über einen langen Zeitraum agrarstrukturpolitische<br />
und andere sektorale Ziele den Privatisierungsprozess. Vor allem sollte<br />
in den Unternehmen der neuen Bundesländer der im Durchschnitt sehr geringe Eigentumsanteil<br />
an selbst bewirtschafteten Flächen durch den begünstigten Flächenerwerb erhöht<br />
werden, um die Planungssicherheit und finanzielle Stabilität der Betriebe im Zuge<br />
des Umstrukturierungsprozesses zu verbessern. Erst ab dem Jahr 2007 wurden fiskalpolitische<br />
Ziele bei der Privatisierung deutlich stärker gewichtet.<br />
Der politisch gesteuerte institutionelle Wandel der Privatisierung des ehemals volkseigenen<br />
Bodens wurde von einigen zentralen Akteuren maßgeblich beeinflusst. Hierzu gehörten<br />
die Bundesministerien BMF und BMELF sowie die Landesregierungen der fünf neuen<br />
Bundesländer sowie die Interessenverbände (Deutscher Bauernverband (DBV) und der<br />
Zusammenschluss ehemaliger Bodeneigentümer zur Arbeitsgemeinschaft für Agrarfragen).<br />
Der Prozess erwies sich wegen der unterschiedlichen Interessen der beteiligten Akteure<br />
und der erheblichen Privatisierungs- und damit Finanzmasse als überaus komplex,<br />
konfliktträchtig und langwierig (GERKE, <strong>2008</strong>; vgl. KLAGES, 2001, S. 129 ff.). Im Folgenden<br />
werden die aus diesem Prozess resultierenden konkret umgesetzten Privatisierungskonzepte<br />
dargestellt, soweit dies für die vorliegende Studie zu den Aktivitäten nichtlandwirtschaftlicher<br />
und überregional ausgerichteter Investoren von Bedeutung ist.