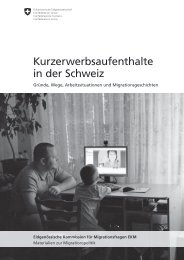De - BASS
De - BASS
De - BASS
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
165Männern. Wie beeinflussen sich Zivilstand und Armut? Bei den Männern ergeben sich zweideutliche Muster: in jeder Zivilstandsgruppe haben die Armen höhere Mortalitätsraten als dieNicht-Armen, und für jede Einkommensgruppe (arm/nicht-arm) haben die Unverheiratetenein höheres Risiko als die Verheirateten. Insbesondere bei den verwitweten undgeschiedenen armen Männern ergibt sich ein Multiplikationseffekt: ihr Mortalitätsrisiko istgrösser als die Risiken für Armut bzw. Verwitwung/Scheidung für sich allein. Bei den Frauenergibt sich nur bei den ledigen Armen ein geringer Interaktionseffekt. 105 Smith/Waitzman(1994) interpretieren ihre Resultate dahingehend, dass die gesundheitsfördernde Wirkungder Ehe für diejenigen am grössten sei, die nicht auf ausserfamiliäre Ressourcenzurückgreifen können, nämlich für die Armen. Die Ehe ist für arme Männer eine der wenigenQuellen von Unterstützung, während reichere Personen besseren Zugang zu formellenUnterstützungsangeboten haben:"Nonpoor persons simply enjoy fewer health benefits, if they are not married. Those who are married havefewer health benefits if they are poor. Among those who are both poor and nonmarried, however, the lackof one source of support is compensated less fully by a second source of support." (Smith/Waitzman 1994,505).Die Autoren haben jedoch keine befriedigende Erklärung für die schwächeren Interaktionseffektevon Zivilstand und Armut bei den Frauen.Für alleinerziehende Frauen haben Suter et al. (1996) generell hohe gesundheitliche Belastungenim Vergleich zu verheirateten oder kinderlosen Frauen festgestellt. Die Diskrepanzverschärft sich noch für die Gruppe der einkommensschwachen Alleinerziehenden. Währendrund ein Viertel der befragten Alleinerziehenden unter häufigen Alltagsbeschwerden 106leiden und ein Fünftel unter häufigen Beeinträchtigungen des psychischen Wohlbefindens 107 ,sind es bei den Einkommensschwachen rund 40 Prozent mit Alltagsbeschwerden und rund30 Prozent mit psychischen Problemen.4.2.4.2. KinderIn der Forschungsliteratur wird eine breite Palette von negativen Konsequenzen von Armutfür das physische und psychische Wohlbefinden von Kindern dokumentiert. Arme Kinderentwickeln häufiger Verhaltensstörungen, psychische Probleme und haben einen generellschlechteren Gesundheitszustand (Adams et al. 1994, Gorlick 1988, Kaplan-Sanoff et al.1991, McLeod/Shanahan 1993). Kinder mit emotionalen Problemen leiden überdurchschnittlichhäufig auch an physischen Krankheiten – oft an solchen, die auf psychosomatischeUrsachen verweisen wie z.B. Allergien, Asthma , Kopfschmerzen o.ä. (Angel/Angel1996). Kinder aus Familien mit niedrigem Einkommen werden aber häufig nicht zum Arzt geschicktund erhalten vor allem selten spezielle psychologische/psychiatrische Betreuung beiemotionalen Problemen (ebd.). Erklärungsansätze für die grössere gesundheitliche Anfälligkeitarmer Kinder beziehen sich auf medizinisch-biologische Risikofaktoren, auf das Er-105 Kinder haben nur einen marginalen Effekt bezüglich Mortalitätsraten; d.h. ein komplexerer Indikator für dieHaushaltsstruktur bringt keinen Erkenntnisgewinn gegenüber der einfachen Feststellung des Zivilstandes.106 Zum Beispiel Kopfweh, Husten, Rückenschmerzen, Magenbeschwerden o.ä.107 Zum Beispiel leicht depressive Stimmung, Nervosität, Unkonzentriertheit, Verstimmung o.ä.B A S S • B ü r o f ü r a r b e i t s - u n d s o z i a l p o l i t i s c h e S t u d i e n