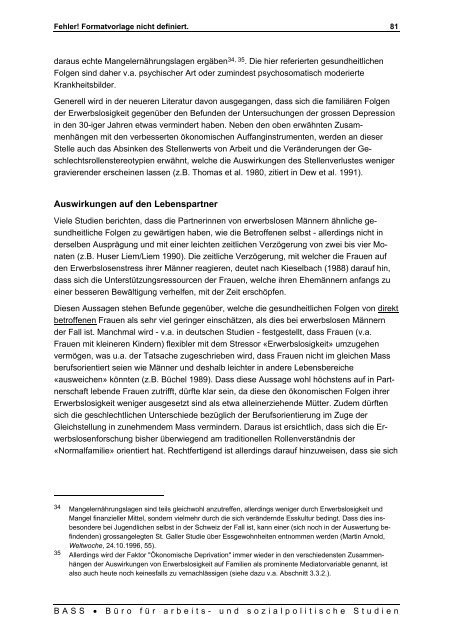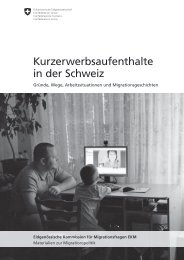De - BASS
De - BASS
De - BASS
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Fehler! Formatvorlage nicht definiert. 81daraus echte Mangelernährungslagen ergäben 34, 35 . Die hier referierten gesundheitlichenFolgen sind daher v.a. psychischer Art oder zumindest psychosomatisch moderierteKrankheitsbilder.Generell wird in der neueren Literatur davon ausgegangen, dass sich die familiären Folgender Erwerbslosigkeit gegenüber den Befunden der Untersuchungen der grossen <strong>De</strong>pressionin den 30-iger Jahren etwas vermindert haben. Neben den oben erwähnten Zusammenhängenmit den verbesserten ökonomischen Auffanginstrumenten, werden an dieserStelle auch das Absinken des Stellenwerts von Arbeit und die Veränderungen der Geschlechtsrollenstereotypienerwähnt, welche die Auswirkungen des Stellenverlustes wenigergravierender erscheinen lassen (z.B. Thomas et al. 1980, zitiert in <strong>De</strong>w et al. 1991).Auswirkungen auf den LebenspartnerViele Studien berichten, dass die Partnerinnen von erwerbslosen Männern ähnliche gesundheitlicheFolgen zu gewärtigen haben, wie die Betroffenen selbst - allerdings nicht inderselben Ausprägung und mit einer leichten zeitlichen Verzögerung von zwei bis vier Monaten(z.B. Huser Liem/Liem 1990). Die zeitliche Verzögerung, mit welcher die Frauen aufden Erwerbslosenstress ihrer Männer reagieren, deutet nach Kieselbach (1988) darauf hin,dass sich die Unterstützungsressourcen der Frauen, welche ihren Ehemännern anfangs zueiner besseren Bewältigung verhelfen, mit der Zeit erschöpfen.Diesen Aussagen stehen Befunde gegenüber, welche die gesundheitlichen Folgen von direktbetroffenen Frauen als sehr viel geringer einschätzen, als dies bei erwerbslosen Männernder Fall ist. Manchmal wird - v.a. in deutschen Studien - festgestellt, dass Frauen (v.a.Frauen mit kleineren Kindern) flexibler mit dem Stressor «Erwerbslosigkeit» umzugehenvermögen, was u.a. der Tatsache zugeschrieben wird, dass Frauen nicht im gleichen Massberufsorientiert seien wie Männer und deshalb leichter in andere Lebensbereiche«ausweichen» könnten (z.B. Büchel 1989). Dass diese Aussage wohl höchstens auf in Partnerschaftlebende Frauen zutrifft, dürfte klar sein, da diese den ökonomischen Folgen ihrerErwerbslosigkeit weniger ausgesetzt sind als etwa alleinerziehende Mütter. Zudem dürftensich die geschlechtlichen Unterschiede bezüglich der Berufsorientierung im Zuge derGleichstellung in zunehmendem Mass vermindern. Daraus ist ersichtlich, dass sich die Erwerbslosenforschungbisher überwiegend am traditionellen Rollenverständnis der«Normalfamilie» orientiert hat. Rechtfertigend ist allerdings darauf hinzuweisen, dass sie sich34 Mangelernährungslagen sind teils gleichwohl anzutreffen, allerdings weniger durch Erwerbslosigkeit undMangel finanzieller Mittel, sondern vielmehr durch die sich verändernde Esskultur bedingt. Dass dies insbesonderebei Jugendlichen selbst in der Schweiz der Fall ist, kann einer (sich noch in der Auswertung befindenden)grossangelegten St. Galler Studie über Essgewohnheiten entnommen werden (Martin Arnold,Weltwoche, 24.10.1996, 55).35 Allerdings wird der Faktor "Ökonomische <strong>De</strong>privation" immer wieder in den verschiedensten Zusammenhängender Auswirkungen von Erwerbslosigkeit auf Familien als prominente Mediatorvariable genannt, istalso auch heute noch keinesfalls zu vernachlässigen (siehe dazu v.a. Abschnitt 3.3.2.).B A S S • B ü r o f ü r a r b e i t s - u n d s o z i a l p o l i t i s c h e S t u d i e n