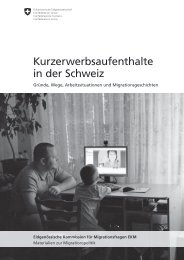De - BASS
De - BASS
De - BASS
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Fehler! Formatvorlage nicht definiert. 90Für viele Frauen (und Männer) stellt die Frage nach der Vereinbarkeit von Beruf undFamilie ein Problem dar. Zunehmend fällt der Entscheid zugunsten des Berufes undgegen die Familie aus.Auch die erwähnten fünf Faktorenbündel führen allerdings nicht viel weiter: "Die Entscheidungfür Kinder wird durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Monokausale Erklärungsversuchetreffen die Problematik nicht. Das Gewicht der einzelnen Faktoren ist sowohlin seiner relativen wie absoluten Bedeutung unbekannt" (Herder-Dorneich 1986, 23). "Sosehr man sich auch bemüht hat, Ursachen zu isolieren, so wenig scheint es möglich, durchUrsachentherapie (Veränderung einzelner Faktoren) zum Erfolg zu kommen" (Herder-Dorneich1986, 20).Höhn/Schubnell (1986) versuchten ihrerseits in einem Überblicksaufsatz die sehr breite Literaturzu den Ursachen des Geburtenrückgangs in Ursachengruppen zu systematisieren. Imvorliegenden Zusammenhang lassen sich indirekte Schlüsse auf die Fruchtbarkeit ziehen.Daraus ergibt sich folgendes Bild (Höhn/Schubnell 1986, 9ff.):1. Allgemein wird akzeptiert, dass es sich beim Geburtenrückgang um ein Phänomen vongrosser Tragweite, Allgemeinheit und Gleichzeitigkeit handelt. Kein spezifisch nationalerFaktor kann deshalb eine zufriedenstellende Erklärung liefern.2. Übereinstimmung besteht auch darin, dass jede monokausale Erklärung unzureichendist, da die Zahl der Einflussfaktoren auf menschliches Verhalten, auf die individuelle Entscheidungüber die Zahl der Kinder und den Zeitpunkt der Geburt, ausserordentlichgross, in den Sozialschichten unterschiedlich ist, und dass sich diese Faktoren im Zeitablaufauch verändern.3. Folgende Faktoren werden, in meist unterschiedlicher Reihenfolge, als besonders wirksamfür die Entscheidung, die Kinderzahl zu begrenzen, genannt:a. Die Zunahme des Anteils ausserhäuslich erwerbstätiger verheirateter Frauen.b. Die Wohnraumsituation, vor allem in den Ballungsgebieten.c. Unzureichende oder regional fehlende Infrastruktur an sozialen Diensten, insbesonderezur Betreuung von Kindern erwerbstätiger Frauen.d. Ansteigen der direkten Kosten und der Zeitaufwendungen für Kinder im Zusammenhangmit einer allgemeinen Steigerung des Anspruchsniveaus.e. nicht messbare Einflussgrössen wie:◦ der Widerstreit von Zielen und Werten, die ein Mensch im Leben verwirklichenmöchte,◦ die Auffassung über die Rolle der Partnerin, des Partners in Ehe und Familie,◦ der Einfluss von Normen und Lebensvorstellungen,◦ die Intensität noch vorhandener Bindungen an ethische oder kirchliche Normenund Gebote.Erwerbslosigkeit und Fruchtbarkeit - theoretische ArbeitenZimmermann/<strong>De</strong> New (1990) versuchen innerhalb eines neoklassischen familienökonomischenModells den Einfluss der Erwerbslosigkeit zu modellieren. Innerhalb des Grundmodellswerden folgende Variablen berücksichtigt: die Anzahl Kinder, die KonsumgüterB A S S • B ü r o f ü r a r b e i t s - u n d s o z i a l p o l i t i s c h e S t u d i e n