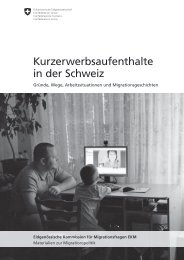De - BASS
De - BASS
De - BASS
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Fehler! Formatvorlage nicht definiert. 84überhaupt annahm (Penkower et al. 1988, zitiert in <strong>De</strong>w et al. 1991) fand keine entsprechendeEvidenz für diese Hypothese.<strong>De</strong>w et al. (1991) weisen darauf hin, dass nicht bekannt ist, ob sich ähnliche Reaktionsmusterauch bei erwerbslosen Frauen und ihren Partnern finden lassen. Hierzu zitiert hingegenKieselbach (1988) zwei epidemiologische Studien aus Grossbritannien. Danach berichtetBebbington et al. (1981) von einer "deutlich höheren (wenngleich statistisch nicht signifikanten)Rate psychischer Störungen" bei Frauen erwerbsloser Männer (28.1 Prozent gegenüber17.8 Prozent bei Frauen von Erwerbstätigen). Bei Männern fanden sich interessanterweisegenau entgegengesetzte Ergebnisse: "Männer mit berufstätigen Frauen zeigtenhäufiger psychische Störungen als jene, deren Frauen nicht beschäftigt waren." In derzweiten Studie fand sich dagegen keine Wirkung des Erwerbsstatus der Frauen auf dieSymptombelastungen der Männer (Cochrane/Stopes-Roe 1980, beide Studien zitiert in Kieselbach1988). Dieser Punkt bleibt also ungeklärt.Auswirkungen auf die Kinder und JugendlichenZenke/Ludwig (1985a) berichten von vielfältigen und beängstigenden Folgen für Kinder (diemeisten zwischen 9- und 15-jährig) mit zunehmender Dauer der elterlichen Erwerbslosigkeit.In bezug auf die Gesundheit sind dies "bei kleineren Kindern Bettnässen, Schlafstörungen;allgemein: autoaggressives Verhalten, Ernährungsprobleme, Konzentrationsschwächen,gesteigerter Drogenkonsum - Rauchen, Alkohol" (ebd., 272). (Zum eingeschränktenGültigkeitsbereich dieser ExpertInnenbefragung siehe Abschnitt 3.3.2.2 «Auswirkungen aufdie Kinder und Jugendlichen»). Insbesondere die Arbeiten aus der Zeit derWeltwirtschaftskrise kommen zu denselben negativen Einschätzungen (Heinrich 1932, Dunn1934, Schneider 1932 alle zitiert in Kieselbach 1988). Auch aus neueren Untersuchungenscheint hervorzugehen, dass Kinder durch elterliche Erwerbslosigkeit in ihrem körperlichenund psychischen Wohlbefinden beeinträchtigt werden können. So berichten etwaMargolis/Farran (1981, zitiert in Kieselbach 1988) in ihrer Studie über die Gesundheitsverläufebetroffener Kinder von einer generellen Zunahme von Krankheiten(insbesondere Infektions- und chronische Krankheiten) gegenüber einer Kontrollgruppenicht-betroffener Kinder. Weiter werden vielfältige psychosomatische Symptome(Coopersmith 1969, zitiert in Schindler/Wetzels 1989), ein höheres Unfallrisiko (Fagin/Little1984, zitiert in Baarda et al. 1990) sowie eine generelle Verschlechterung des allgemeinenpsychischen Wohlbefindens (Baarda et al. 1983, Schindler/Wetzels 1985, zitiert in Schindler/Wetzels1989) genannt. Verschiedene AutorInnen weisen darauf hin, dass es sich dabeium indirekte Auswirkungen der elterlichen Erwerbslosigkeit handelt, vermittelt v.a. durch denGesundheitszustand und die (negativen) Bewältigungsstrategien der Eltern, sowie demwahrgenommenen ökonomischen Stress.<strong>De</strong>w et al. (1991) streichen jedoch die methodische Schwäche vieler Studien im englischenSprachraum heraus. Es handle sich dabei grösstenteils um Querschnittsdaten ohne Kontrollgruppen-<strong>De</strong>signund zudem würden die Daten meist durch Befragung der Eltern undnicht der Kinder selbst erhoben. <strong>De</strong>r Schluss auf kausale Effekte sei deshalb kaum zulässig.Wir teilen diese Einschätzung, zumal die Datenlage unter der neueren Literatur sehrwidersprüchlich ist. Zwar sind die deutschen und niederländischen Untersuchungen me-B A S S • B ü r o f ü r a r b e i t s - u n d s o z i a l p o l i t i s c h e S t u d i e n