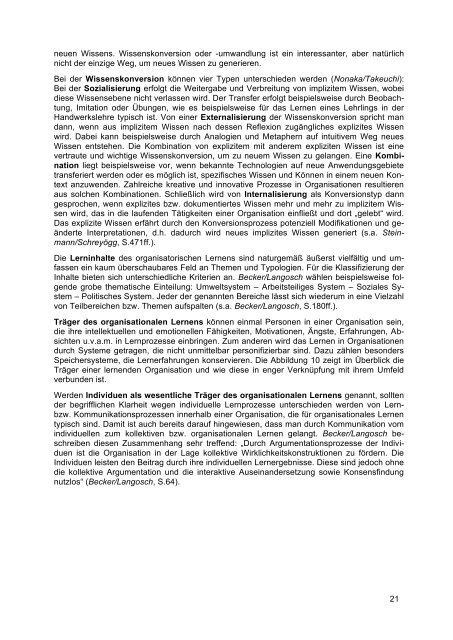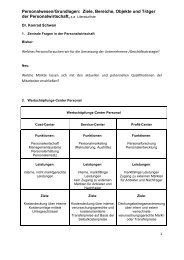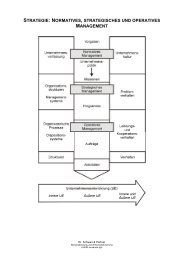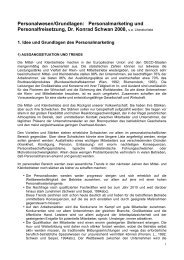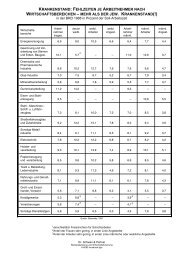Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
neuen Wissens. Wissenskonversion o<strong>der</strong> -umwandlung ist ein interessanter, aber natürlich<br />
nicht <strong>der</strong> einzige Weg, um neues Wissen zu generieren.<br />
Bei <strong>der</strong> Wissenskonversion können vier Typen unterschieden werden (Nonaka/Takeuchi):<br />
Bei <strong>der</strong> Sozialisierung erfolgt die Weitergabe und Verbreitung von implizitem Wissen, wobei<br />
diese Wissensebene nicht verlassen wird. Der Transfer erfolgt beispielsweise durch Beobachtung,<br />
Imitation o<strong>der</strong> Übungen, wie es beispielsweise für das Lernen eines Lehrlings in <strong>der</strong><br />
Handwerkslehre typisch ist. Von einer Externalisierung <strong>der</strong> Wissenskonversion spricht man<br />
dann, wenn aus implizitem Wissen nach dessen Reflexion zugängliches explizites Wissen<br />
wird. Dabei kann beispielsweise durch Analogien und Metaphern auf intuitivem Weg neues<br />
Wissen entstehen. Die Kombination von explizitem mit an<strong>der</strong>em expliziten Wissen ist eine<br />
vertraute und wichtige Wissenskonversion, um zu neuem Wissen zu gelangen. Eine Kombination<br />
liegt beispielsweise vor, wenn bekannte Technologien auf neue Anwendungsgebiete<br />
transferiert werden o<strong>der</strong> es möglich ist, spezifisches Wissen und Können in einem neuen Kontext<br />
anzuwenden. Zahlreiche kreative und innovative Prozesse in <strong>Organisation</strong>en resultieren<br />
aus solchen Kombinationen. Schließlich wird von Internalisierung als Konversionstyp dann<br />
gesprochen, wenn explizites bzw. dokumentiertes Wissen mehr und mehr zu implizitem Wissen<br />
wird, das in die laufenden Tätigkeiten einer <strong>Organisation</strong> einfließt und dort „gelebt“ wird.<br />
Das explizite Wissen erfährt durch den Konversionsprozess potenziell Modifikationen und geän<strong>der</strong>te<br />
Interpretationen, d.h. dadurch wird neues implizites Wissen generiert (s.a. Steinmann/Schreyögg,<br />
S.471ff.).<br />
Die Lerninhalte des organisatorischen Lernens sind naturgemäß äußerst vielfältig und umfassen<br />
ein kaum überschaubares Feld an Themen und Typologien. Für die Klassifizierung <strong>der</strong><br />
Inhalte bieten sich unterschiedliche Kriterien an. Becker/Langosch wählen beispielsweise folgende<br />
grobe thematische Einteilung: Umweltsystem – Arbeitsteiliges System – Soziales System<br />
– Politisches System. Je<strong>der</strong> <strong>der</strong> genannten Bereiche lässt sich wie<strong>der</strong>um in eine Vielzahl<br />
von Teilbereichen bzw. Themen aufspalten (s.a. Becker/Langosch, S.180ff.).<br />
Träger des organisationalen Lernens können einmal Personen in einer <strong>Organisation</strong> sein,<br />
die ihre intellektuellen und emotionellen Fähigkeiten, Motivationen, Ängste, Erfahrungen, Absichten<br />
u.v.a.m. in Lernprozesse einbringen. Zum an<strong>der</strong>en wird das Lernen in <strong>Organisation</strong>en<br />
durch Systeme getragen, die nicht unmittelbar personifizierbar sind. Dazu zählen beson<strong>der</strong>s<br />
Speichersysteme, die Lernerfahrungen konservieren. Die Abbildung 10 zeigt im Überblick die<br />
Träger einer lernenden <strong>Organisation</strong> und wie diese in enger Verknüpfung mit ihrem Umfeld<br />
verbunden ist.<br />
Werden Individuen als wesentliche Träger des organisationalen Lernens genannt, sollten<br />
<strong>der</strong> begrifflichen Klarheit wegen individuelle Lernprozesse unterschieden werden von Lern-<br />
bzw. Kommunikationsprozessen innerhalb einer <strong>Organisation</strong>, die für organisationales Lernen<br />
typisch sind. Damit ist auch bereits darauf hingewiesen, dass man durch Kommunikation vom<br />
individuellen zum kollektiven bzw. organisationalen Lernen gelangt. Becker/Langosch beschreiben<br />
diesen Zusammenhang sehr treffend: „Durch Argumentationsprozesse <strong>der</strong> Individuen<br />
ist die <strong>Organisation</strong> in <strong>der</strong> Lage kollektive Wirklichkeitskonstruktionen zu för<strong>der</strong>n. Die<br />
Individuen leisten den Beitrag durch ihre individuellen Lernergebnisse. Diese sind jedoch ohne<br />
die kollektive Argumentation und die interaktive Auseinan<strong>der</strong>setzung sowie Konsensfindung<br />
nutzlos“ (Becker/Langosch, S.64).<br />
21