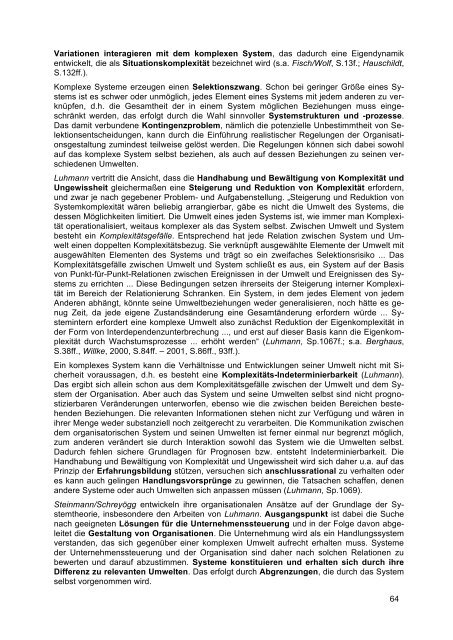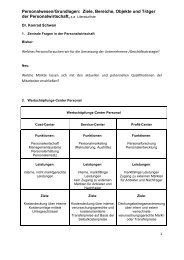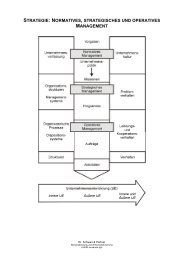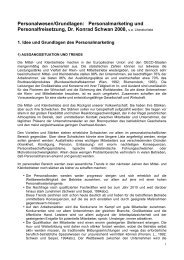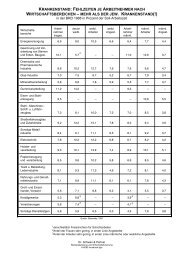Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Variationen interagieren mit dem komplexen System, das dadurch eine Eigendynamik<br />
entwickelt, die als Situationskomplexität bezeichnet wird (s.a. Fisch/Wolf, S.13f.; Hauschildt,<br />
S.132ff.).<br />
Komplexe Systeme erzeugen einen Selektionszwang. Schon bei geringer Größe eines Systems<br />
ist es schwer o<strong>der</strong> unmöglich, jedes Element eines Systems mit jedem an<strong>der</strong>en zu verknüpfen,<br />
d.h. die Gesamtheit <strong>der</strong> in einem System möglichen Beziehungen muss eingeschränkt<br />
werden, das erfolgt durch die Wahl sinnvoller Systemstrukturen und -prozesse.<br />
Das damit verbundene Kontingenzproblem, nämlich die potenzielle Unbestimmtheit von Selektionsentscheidungen,<br />
kann durch die Einführung realistischer Regelungen <strong>der</strong> <strong>Organisation</strong>sgestaltung<br />
zumindest teilweise gelöst werden. Die Regelungen können sich dabei sowohl<br />
auf das komplexe System selbst beziehen, als auch auf dessen Beziehungen zu seinen verschiedenen<br />
Umwelten.<br />
Luhmann vertritt die Ansicht, dass die Handhabung und Bewältigung von Komplexität und<br />
Ungewissheit gleichermaßen eine Steigerung und Reduktion von Komplexität erfor<strong>der</strong>n,<br />
und zwar je nach gegebener Problem- und Aufgabenstellung. „Steigerung und Reduktion von<br />
Systemkomplexität wären beliebig arrangierbar, gäbe es nicht die Umwelt des Systems, die<br />
dessen Möglichkeiten limitiert. Die Umwelt eines jeden Systems ist, wie immer man Komplexität<br />
operationalisiert, weitaus komplexer als das System selbst. Zwischen Umwelt und System<br />
besteht ein Komplexitätsgefälle. Entsprechend hat jede Relation zwischen System und Umwelt<br />
einen doppelten Komplexitätsbezug. Sie verknüpft ausgewählte Elemente <strong>der</strong> Umwelt mit<br />
ausgewählten Elementen des Systems und trägt so ein zweifaches Selektionsrisiko ... Das<br />
Komplexitätsgefälle zwischen Umwelt und System schließt es aus, ein System auf <strong>der</strong> Basis<br />
von Punkt-für-Punkt-Relationen zwischen Ereignissen in <strong>der</strong> Umwelt und Ereignissen des Systems<br />
zu errichten ... Diese Bedingungen setzen ihrerseits <strong>der</strong> Steigerung interner Komplexität<br />
im Bereich <strong>der</strong> Relationierung Schranken. Ein System, in dem jedes Element von jedem<br />
An<strong>der</strong>en abhängt, könnte seine Umweltbeziehungen we<strong>der</strong> generalisieren, noch hätte es genug<br />
Zeit, da jede eigene Zustandsän<strong>der</strong>ung eine Gesamtän<strong>der</strong>ung erfor<strong>der</strong>n würde ... Systemintern<br />
erfor<strong>der</strong>t eine komplexe Umwelt also zunächst Reduktion <strong>der</strong> Eigenkomplexität in<br />
<strong>der</strong> Form von Interdependenzunterbrechung ..., und erst auf dieser Basis kann die Eigenkomplexität<br />
durch Wachstumsprozesse ... erhöht werden“ (Luhmann, Sp.1067f.; s.a. Berghaus,<br />
S.38ff., Willke, 2000, S.84ff. – 2001, S.86ff., 93ff.).<br />
Ein komplexes System kann die Verhältnisse und Entwicklungen seiner Umwelt nicht mit Sicherheit<br />
voraussagen, d.h. es besteht eine Komplexitäts-Indeterminierbarkeit (Luhmann).<br />
Das ergibt sich allein schon aus dem Komplexitätsgefälle zwischen <strong>der</strong> Umwelt und dem System<br />
<strong>der</strong> <strong>Organisation</strong>. Aber auch das System und seine Umwelten selbst sind nicht prognostizierbaren<br />
Verän<strong>der</strong>ungen unterworfen, ebenso wie die zwischen beiden Bereichen bestehenden<br />
Beziehungen. Die relevanten Informationen stehen nicht zur Verfügung und wären in<br />
ihrer Menge we<strong>der</strong> substanziell noch zeitgerecht zu verarbeiten. Die Kommunikation zwischen<br />
dem organisatorischen System und seinen Umwelten ist ferner einmal nur begrenzt möglich,<br />
zum an<strong>der</strong>en verän<strong>der</strong>t sie durch Interaktion sowohl das System wie die Umwelten selbst.<br />
Dadurch fehlen sichere Grundlagen für Prognosen bzw. entsteht Indeterminierbarkeit. Die<br />
Handhabung und Bewältigung von Komplexität und Ungewissheit wird sich daher u.a. auf das<br />
Prinzip <strong>der</strong> Erfahrungsbildung stützen, versuchen sich anschlussrational zu verhalten o<strong>der</strong><br />
es kann auch gelingen Handlungsvorsprünge zu gewinnen, die Tatsachen schaffen, denen<br />
an<strong>der</strong>e Systeme o<strong>der</strong> auch Umwelten sich anpassen müssen (Luhmann, Sp.1069).<br />
Steinmann/Schreyögg entwickeln ihre organisationalen Ansätze auf <strong>der</strong> Grundlage <strong>der</strong> Systemtheorie,<br />
insbeson<strong>der</strong>e den Arbeiten von Luhmann. Ausgangspunkt ist dabei die Suche<br />
nach geeigneten Lösungen für die Unternehmenssteuerung und in <strong>der</strong> Folge davon abgeleitet<br />
die Gestaltung von <strong>Organisation</strong>en. Die Unternehmung wird als ein Handlungssystem<br />
verstanden, das sich gegenüber einer komplexen Umwelt aufrecht erhalten muss. Systeme<br />
<strong>der</strong> Unternehmenssteuerung und <strong>der</strong> <strong>Organisation</strong> sind daher nach solchen Relationen zu<br />
bewerten und darauf abzustimmen. Systeme konstituieren und erhalten sich durch ihre<br />
Differenz zu relevanten Umwelten. Das erfolgt durch Abgrenzungen, die durch das System<br />
selbst vorgenommen wird.<br />
64