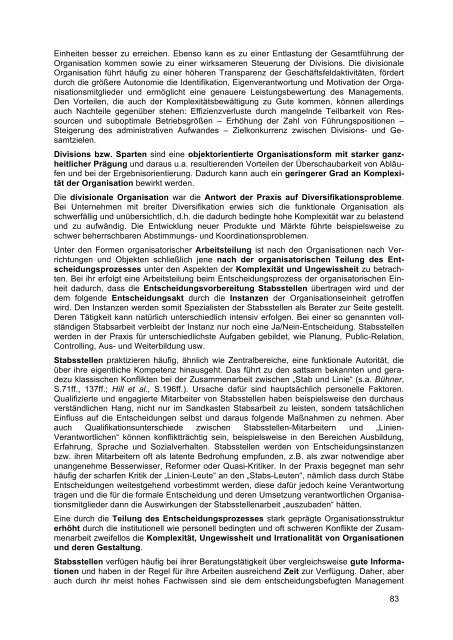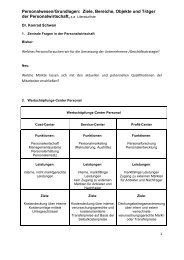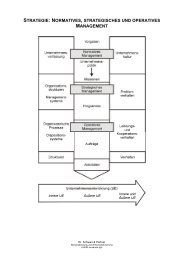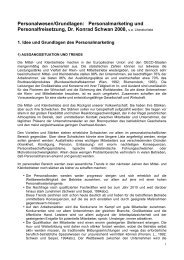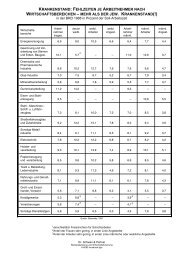Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Einheiten besser zu erreichen. Ebenso kann es zu einer Entlastung <strong>der</strong> Gesamtführung <strong>der</strong><br />
<strong>Organisation</strong> kommen sowie zu einer wirksameren Steuerung <strong>der</strong> Divisions. Die divisionale<br />
<strong>Organisation</strong> führt häufig zu einer höheren Transparenz <strong>der</strong> Geschäftsfeldaktivitäten, för<strong>der</strong>t<br />
durch die größere Autonomie die Identifikation, Eigenverantwortung und Motivation <strong>der</strong> <strong>Organisation</strong>smitglie<strong>der</strong><br />
und ermöglicht eine genauere Leistungsbewertung des Managements.<br />
Den Vorteilen, die auch <strong>der</strong> Komplexitätsbewältigung zu Gute kommen, können allerdings<br />
auch Nachteile gegenüber stehen: Effizienzverluste durch mangelnde Teilbarkeit von Ressourcen<br />
und suboptimale Betriebsgrößen – Erhöhung <strong>der</strong> Zahl von Führungspositionen –<br />
Steigerung des administrativen Aufwandes – Zielkonkurrenz zwischen Divisions- und Gesamtzielen.<br />
Divisions bzw. Sparten sind eine objektorientierte <strong>Organisation</strong>sform mit starker ganzheitlicher<br />
Prägung und daraus u.a. resultierenden Vorteilen <strong>der</strong> Überschaubarkeit von Abläufen<br />
und bei <strong>der</strong> Ergebnisorientierung. Dadurch kann auch ein geringerer Grad an Komplexität<br />
<strong>der</strong> <strong>Organisation</strong> bewirkt werden.<br />
Die divisionale <strong>Organisation</strong> war die Antwort <strong>der</strong> Praxis auf Diversifikationsprobleme.<br />
Bei Unternehmen mit breiter Diversifikation erwies sich die funktionale <strong>Organisation</strong> als<br />
schwerfällig und unübersichtlich, d.h. die dadurch bedingte hohe Komplexität war zu belastend<br />
und zu aufwändig. Die Entwicklung neuer Produkte und Märkte führte beispielsweise zu<br />
schwer beherrschbaren Abstimmungs- und Koordinationsproblemen.<br />
Unter den Formen organisatorischer Arbeitsteilung ist nach den <strong>Organisation</strong>en nach Verrichtungen<br />
und Objekten schließlich jene nach <strong>der</strong> organisatorischen Teilung des Entscheidungsprozesses<br />
unter den Aspekten <strong>der</strong> Komplexität und Ungewissheit zu betrachten.<br />
Bei ihr erfolgt eine Arbeitsteilung beim Entscheidungsprozess <strong>der</strong> organisatorischen Einheit<br />
dadurch, dass die Entscheidungsvorbereitung Stabsstellen übertragen wird und <strong>der</strong><br />
dem folgende Entscheidungsakt durch die Instanzen <strong>der</strong> <strong>Organisation</strong>seinheit getroffen<br />
wird. Den Instanzen werden somit Spezialisten <strong>der</strong> Stabsstellen als Berater zur Seite gestellt.<br />
Deren Tätigkeit kann natürlich unterschiedlich intensiv erfolgen. Bei einer so genannten vollständigen<br />
Stabsarbeit verbleibt <strong>der</strong> Instanz nur noch eine Ja/Nein-Entscheidung. Stabsstellen<br />
werden in <strong>der</strong> Praxis für unterschiedlichste Aufgaben gebildet, wie Planung, Public-Relation,<br />
Controlling, Aus- und Weiterbildung usw.<br />
Stabsstellen praktizieren häufig, ähnlich wie Zentralbereiche, eine funktionale Autorität, die<br />
über ihre eigentliche Kompetenz hinausgeht. Das führt zu den sattsam bekannten und geradezu<br />
klassischen Konflikten bei <strong>der</strong> Zusammenarbeit zwischen „Stab und Linie“ (s.a. Bühner,<br />
S.71ff., 137ff.; Hill et al., S.196ff.). Ursache dafür sind hauptsächlich personelle Faktoren.<br />
Qualifizierte und engagierte Mitarbeiter von Stabsstellen haben beispielsweise den durchaus<br />
verständlichen Hang, nicht nur im Sandkasten Stabsarbeit zu leisten, son<strong>der</strong>n tatsächlichen<br />
Einfluss auf die Entscheidungen selbst und daraus folgende Maßnahmen zu nehmen. Aber<br />
auch Qualifikationsunterschiede zwischen Stabsstellen-Mitarbeitern und „Linien-<br />
Verantwortlichen“ können konfliktträchtig sein, beispielsweise in den Bereichen Ausbildung,<br />
Erfahrung, Sprache und Sozialverhalten. Stabsstellen werden von Entscheidungsinstanzen<br />
bzw. ihren Mitarbeitern oft als latente Bedrohung empfunden, z.B. als zwar notwendige aber<br />
unangenehme Besserwisser, Reformer o<strong>der</strong> Quasi-Kritiker. In <strong>der</strong> Praxis begegnet man sehr<br />
häufig <strong>der</strong> scharfen Kritik <strong>der</strong> „Linien-Leute“ an den „Stabs-Leuten“, nämlich dass durch Stäbe<br />
Entscheidungen weitestgehend vorbestimmt werden, diese dafür jedoch keine Verantwortung<br />
tragen und die für die formale Entscheidung und <strong>der</strong>en Umsetzung verantwortlichen <strong>Organisation</strong>smitglie<strong>der</strong><br />
dann die Auswirkungen <strong>der</strong> Stabsstellenarbeit „auszubaden“ hätten.<br />
Eine durch die Teilung des Entscheidungsprozesses stark geprägte <strong>Organisation</strong>sstruktur<br />
erhöht durch die institutionell wie personell bedingten und oft schweren Konflikte <strong>der</strong> Zusammenarbeit<br />
zweifellos die Komplexität, Ungewissheit und Irrationalität von <strong>Organisation</strong>en<br />
und <strong>der</strong>en Gestaltung.<br />
Stabsstellen verfügen häufig bei ihrer Beratungstätigkeit über vergleichsweise gute Informationen<br />
und haben in <strong>der</strong> Regel für ihre Arbeiten ausreichend Zeit zur Verfügung. Daher, aber<br />
auch durch ihr meist hohes Fachwissen sind sie dem entscheidungsbefugten Management<br />
83