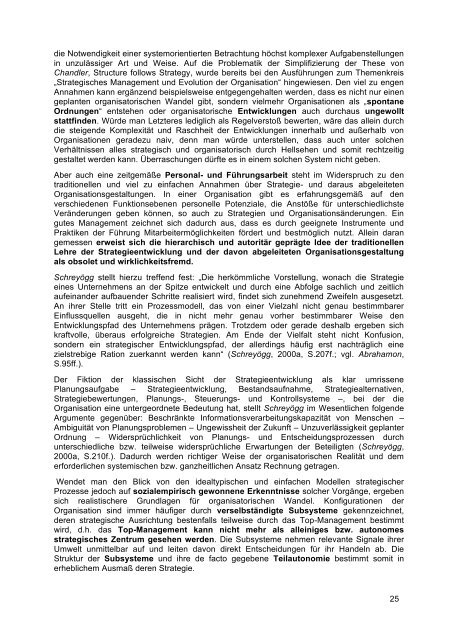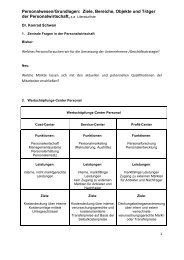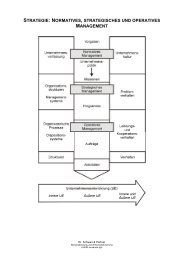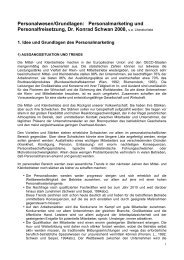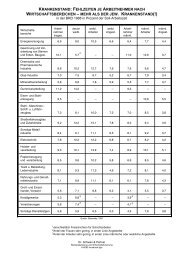Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
die Notwendigkeit einer systemorientierten Betrachtung höchst komplexer Aufgabenstellungen<br />
in unzulässiger Art und Weise. Auf die Problematik <strong>der</strong> Simplifizierung <strong>der</strong> These von<br />
Chandler, Structure follows Strategy, wurde bereits bei den Ausführungen zum Themenkreis<br />
„Strategisches Management und Evolution <strong>der</strong> <strong>Organisation</strong>“ hingewiesen. Den viel zu engen<br />
Annahmen kann ergänzend beispielsweise entgegengehalten werden, dass es nicht nur einen<br />
geplanten organisatorischen <strong>Wandel</strong> gibt, son<strong>der</strong>n vielmehr <strong>Organisation</strong>en als „spontane<br />
Ordnungen“ entstehen o<strong>der</strong> organisatorische Entwicklungen auch durchaus ungewollt<br />
stattfinden. Würde man Letzteres lediglich als Regelverstoß bewerten, wäre das allein durch<br />
die steigende Komplexität und Raschheit <strong>der</strong> Entwicklungen innerhalb und außerhalb von<br />
<strong>Organisation</strong>en geradezu naiv, denn man würde unterstellen, dass auch unter solchen<br />
Verhältnissen alles strategisch und organisatorisch durch Hellsehen und somit rechtzeitig<br />
gestaltet werden kann. Überraschungen dürfte es in einem solchen System nicht geben.<br />
Aber auch eine zeitgemäße Personal- und Führungsarbeit steht im Wi<strong>der</strong>spruch zu den<br />
traditionellen und viel zu einfachen Annahmen über Strategie- und daraus abgeleiteten<br />
<strong>Organisation</strong>sgestaltungen. In einer <strong>Organisation</strong> gibt es erfahrungsgemäß auf den<br />
verschiedenen Funktionsebenen personelle Potenziale, die Anstöße für unterschiedlichste<br />
Verän<strong>der</strong>ungen geben können, so auch zu Strategien und <strong>Organisation</strong>sän<strong>der</strong>ungen. Ein<br />
gutes Management zeichnet sich dadurch aus, dass es durch geeignete Instrumente und<br />
Praktiken <strong>der</strong> Führung Mitarbeitermöglichkeiten för<strong>der</strong>t und bestmöglich nutzt. Allein daran<br />
gemessen erweist sich die hierarchisch und autoritär geprägte Idee <strong>der</strong> traditionellen<br />
Lehre <strong>der</strong> Strategieentwicklung und <strong>der</strong> davon abgeleiteten <strong>Organisation</strong>sgestaltung<br />
als obsolet und wirklichkeitsfremd.<br />
Schreyögg stellt hierzu treffend fest: „Die herkömmliche Vorstellung, wonach die Strategie<br />
eines Unternehmens an <strong>der</strong> Spitze entwickelt und durch eine Abfolge sachlich und zeitlich<br />
aufeinan<strong>der</strong> aufbauen<strong>der</strong> Schritte realisiert wird, findet sich zunehmend Zweifeln ausgesetzt.<br />
An ihrer Stelle tritt ein Prozessmodell, das von einer Vielzahl nicht genau bestimmbarer<br />
Einflussquellen ausgeht, die in nicht mehr genau vorher bestimmbarer Weise den<br />
Entwicklungspfad des Unternehmens prägen. Trotzdem o<strong>der</strong> gerade deshalb ergeben sich<br />
kraftvolle, überaus erfolgreiche Strategien. Am Ende <strong>der</strong> Vielfalt steht nicht Konfusion,<br />
son<strong>der</strong>n ein strategischer Entwicklungspfad, <strong>der</strong> allerdings häufig erst nachträglich eine<br />
zielstrebige Ration zuerkannt werden kann“ (Schreyögg, 2000a, S.207f.; vgl. Abrahamon,<br />
S.95ff.).<br />
Der Fiktion <strong>der</strong> klassischen Sicht <strong>der</strong> Strategieentwicklung als klar umrissene<br />
Planungsaufgabe – Strategieentwicklung, Bestandsaufnahme, Strategiealternativen,<br />
Strategiebewertungen, Planungs-, Steuerungs- und Kontrollsysteme –, bei <strong>der</strong> die<br />
<strong>Organisation</strong> eine untergeordnete Bedeutung hat, stellt Schreyögg im Wesentlichen folgende<br />
Argumente gegenüber: Beschränkte Informationsverarbeitungskapazität von Menschen –<br />
Ambiguität von Planungsproblemen – Ungewissheit <strong>der</strong> Zukunft – Unzuverlässigkeit geplanter<br />
Ordnung – Wi<strong>der</strong>sprüchlichkeit von Planungs- und Entscheidungsprozessen durch<br />
unterschiedliche bzw. teilweise wi<strong>der</strong>sprüchliche Erwartungen <strong>der</strong> Beteiligten (Schreyögg,<br />
2000a, S.210f.). Dadurch werden richtiger Weise <strong>der</strong> organisatorischen Realität und dem<br />
erfor<strong>der</strong>lichen systemischen bzw. ganzheitlichen Ansatz Rechnung getragen.<br />
Wendet man den Blick von den idealtypischen und einfachen Modellen strategischer<br />
Prozesse jedoch auf sozialempirisch gewonnene Erkenntnisse solcher Vorgänge, ergeben<br />
sich realistischere Grundlagen für organisatorischen <strong>Wandel</strong>. Konfigurationen <strong>der</strong><br />
<strong>Organisation</strong> sind immer häufiger durch verselbständigte Subsysteme gekennzeichnet,<br />
<strong>der</strong>en strategische Ausrichtung bestenfalls teilweise durch das Top-Management bestimmt<br />
wird, d.h. das Top-Management kann nicht mehr als alleiniges bzw. autonomes<br />
strategisches Zentrum gesehen werden. Die Subsysteme nehmen relevante Signale ihrer<br />
Umwelt unmittelbar auf und leiten davon direkt Entscheidungen für ihr Handeln ab. Die<br />
Struktur <strong>der</strong> Subsysteme und ihre de facto gegebene Teilautonomie bestimmt somit in<br />
erheblichem Ausmaß <strong>der</strong>en Strategie.<br />
25