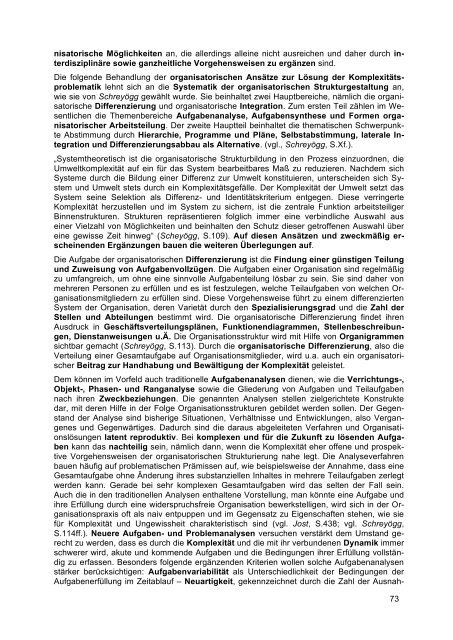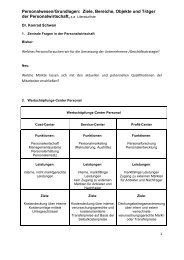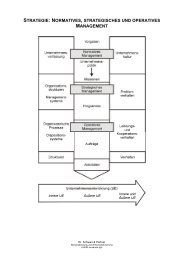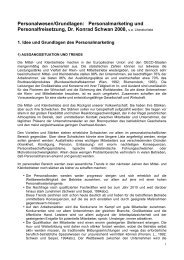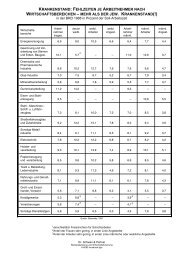Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
nisatorische Möglichkeiten an, die allerdings alleine nicht ausreichen und daher durch interdisziplinäre<br />
sowie ganzheitliche Vorgehensweisen zu ergänzen sind.<br />
Die folgende Behandlung <strong>der</strong> organisatorischen Ansätze zur Lösung <strong>der</strong> Komplexitätsproblematik<br />
lehnt sich an die Systematik <strong>der</strong> organisatorischen Strukturgestaltung an,<br />
wie sie von Schreyögg gewählt wurde. Sie beinhaltet zwei Hauptbereiche, nämlich die organisatorische<br />
Differenzierung und organisatorische Integration. Zum ersten Teil zählen im Wesentlichen<br />
die Themenbereiche Aufgabenanalyse, Aufgabensynthese und Formen organisatorischer<br />
Arbeitsteilung. Der zweite Hauptteil beinhaltet die thematischen Schwerpunkte<br />
Abstimmung durch Hierarchie, Programme und Pläne, Selbstabstimmung, laterale Integration<br />
und Differenzierungsabbau als Alternative. (vgl., Schreyögg, S.Xf.).<br />
„Systemtheoretisch ist die organisatorische Strukturbildung in den Prozess einzuordnen, die<br />
Umweltkomplexität auf ein für das System bearbeitbares Maß zu reduzieren. Nachdem sich<br />
Systeme durch die Bildung einer Differenz zur Umwelt konstituieren, unterscheiden sich System<br />
und Umwelt stets durch ein Komplexitätsgefälle. Der Komplexität <strong>der</strong> Umwelt setzt das<br />
System seine Selektion als Differenz- und Identitätskriterium entgegen. Diese verringerte<br />
Komplexität herzustellen und im System zu sichern, ist die zentrale Funktion arbeitsteiliger<br />
Binnenstrukturen. Strukturen repräsentieren folglich immer eine verbindliche Auswahl aus<br />
einer Vielzahl von Möglichkeiten und beinhalten den Schutz dieser getroffenen Auswahl über<br />
eine gewisse Zeit hinweg“ (Scheyögg, S.109). Auf diesen Ansätzen und zweckmäßig erscheinenden<br />
Ergänzungen bauen die weiteren Überlegungen auf.<br />
Die Aufgabe <strong>der</strong> organisatorischen Differenzierung ist die Findung einer günstigen Teilung<br />
und Zuweisung von Aufgabenvollzügen. Die Aufgaben einer <strong>Organisation</strong> sind regelmäßig<br />
zu umfangreich, um ohne eine sinnvolle Aufgabenteilung lösbar zu sein. Sie sind daher von<br />
mehreren Personen zu erfüllen und es ist festzulegen, welche Teilaufgaben von welchen <strong>Organisation</strong>smitglie<strong>der</strong>n<br />
zu erfüllen sind. Diese Vorgehensweise führt zu einem differenzierten<br />
System <strong>der</strong> <strong>Organisation</strong>, <strong>der</strong>en Varietät durch den Spezialisierungsgrad und die Zahl <strong>der</strong><br />
Stellen und Abteilungen bestimmt wird. Die organisatorische Differenzierung findet ihren<br />
Ausdruck in Geschäftsverteilungsplänen, Funktionendiagrammen, Stellenbeschreibungen,<br />
Dienstanweisungen u.Ä. Die <strong>Organisation</strong>sstruktur wird mit Hilfe von Organigrammen<br />
sichtbar gemacht (Schreyögg, S.113). Durch die organisatorische Differenzierung, also die<br />
Verteilung einer Gesamtaufgabe auf <strong>Organisation</strong>smitglie<strong>der</strong>, wird u.a. auch ein organisatorischer<br />
Beitrag zur Handhabung und Bewältigung <strong>der</strong> Komplexität geleistet.<br />
Dem können im Vorfeld auch traditionelle Aufgabenanalysen dienen, wie die Verrichtungs-,<br />
Objekt-, Phasen- und Ranganalyse sowie die Glie<strong>der</strong>ung von Aufgaben und Teilaufgaben<br />
nach ihren Zweckbeziehungen. Die genannten Analysen stellen zielgerichtete Konstrukte<br />
dar, mit <strong>der</strong>en Hilfe in <strong>der</strong> Folge <strong>Organisation</strong>sstrukturen gebildet werden sollen. Der Gegenstand<br />
<strong>der</strong> Analyse sind bisherige Situationen, Verhältnisse und Entwicklungen, also Vergangenes<br />
und Gegenwärtiges. Dadurch sind die daraus abgeleiteten Verfahren und <strong>Organisation</strong>slösungen<br />
latent reproduktiv. Bei komplexen und für die Zukunft zu lösenden Aufgaben<br />
kann das nachteilig sein, nämlich dann, wenn die Komplexität eher offene und prospektive<br />
Vorgehensweisen <strong>der</strong> organisatorischen Strukturierung nahe legt. Die Analyseverfahren<br />
bauen häufig auf problematischen Prämissen auf, wie beispielsweise <strong>der</strong> Annahme, dass eine<br />
Gesamtaufgabe ohne Än<strong>der</strong>ung ihres substanziellen Inhaltes in mehrere Teilaufgaben zerlegt<br />
werden kann. Gerade bei sehr komplexen Gesamtaufgaben wird das selten <strong>der</strong> Fall sein.<br />
Auch die in den traditionellen Analysen enthaltene Vorstellung, man könnte eine Aufgabe und<br />
ihre Erfüllung durch eine wi<strong>der</strong>spruchsfreie <strong>Organisation</strong> bewerkstelligen, wird sich in <strong>der</strong> <strong>Organisation</strong>spraxis<br />
oft als naiv entpuppen und im Gegensatz zu Eigenschaften stehen, wie sie<br />
für Komplexität und Ungewissheit charakteristisch sind (vgl. Jost, S.438; vgl. Schreyögg,<br />
S.114ff.). Neuere Aufgaben- und Problemanalysen versuchen verstärkt dem Umstand gerecht<br />
zu werden, dass es durch die Komplexität und die mit ihr verbundenen Dynamik immer<br />
schwerer wird, akute und kommende Aufgaben und die Bedingungen ihrer Erfüllung vollständig<br />
zu erfassen. Beson<strong>der</strong>s folgende ergänzenden Kriterien wollen solche Aufgabenanalysen<br />
stärker berücksichtigen: Aufgabenvariabilität als Unterschiedlichkeit <strong>der</strong> Bedingungen <strong>der</strong><br />
Aufgabenerfüllung im Zeitablauf – Neuartigkeit, gekennzeichnet durch die Zahl <strong>der</strong> Ausnah-<br />
73