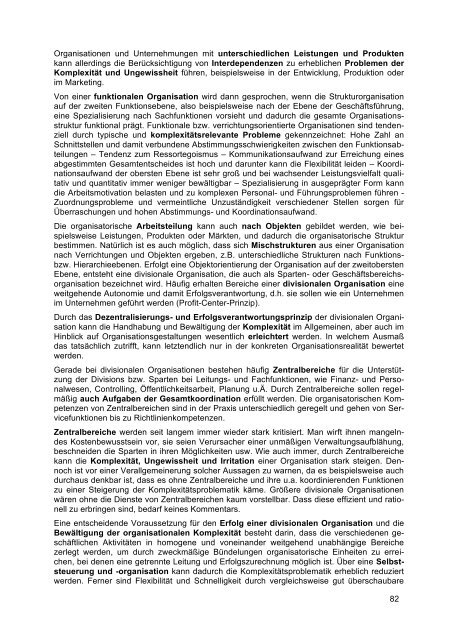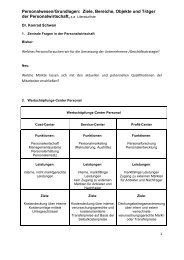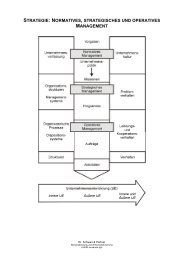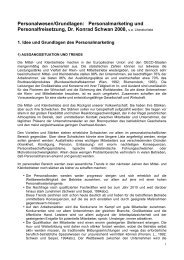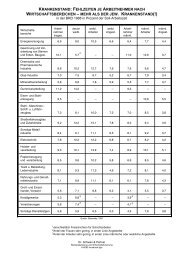Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Organisation</strong>en und Unternehmungen mit unterschiedlichen Leistungen und Produkten<br />
kann allerdings die Berücksichtigung von Interdependenzen zu erheblichen Problemen <strong>der</strong><br />
Komplexität und Ungewissheit führen, beispielsweise in <strong>der</strong> Entwicklung, Produktion o<strong>der</strong><br />
im Marketing.<br />
Von einer funktionalen <strong>Organisation</strong> wird dann gesprochen, wenn die Strukturorganisation<br />
auf <strong>der</strong> zweiten Funktionsebene, also beispielsweise nach <strong>der</strong> Ebene <strong>der</strong> Geschäftsführung,<br />
eine Spezialisierung nach Sachfunktionen vorsieht und dadurch die gesamte <strong>Organisation</strong>sstruktur<br />
funktional prägt. Funktionale bzw. verrichtungsorientierte <strong>Organisation</strong>en sind tendenziell<br />
durch typische und komplexitätsrelevante Probleme gekennzeichnet: Hohe Zahl an<br />
Schnittstellen und damit verbundene Abstimmungsschwierigkeiten zwischen den Funktionsabteilungen<br />
– Tendenz zum Ressortegoismus – Kommunikationsaufwand zur Erreichung eines<br />
abgestimmten Gesamtentscheides ist hoch und darunter kann die Flexibilität leiden – Koordinationsaufwand<br />
<strong>der</strong> obersten Ebene ist sehr groß und bei wachsen<strong>der</strong> Leistungsvielfalt qualitativ<br />
und quantitativ immer weniger bewältigbar – Spezialisierung in ausgeprägter Form kann<br />
die Arbeitsmotivation belasten und zu komplexen Personal- und Führungsproblemen führen -<br />
Zuordnungsprobleme und vermeintliche Unzuständigkeit verschiedener Stellen sorgen für<br />
Überraschungen und hohen Abstimmungs- und Koordinationsaufwand.<br />
Die organisatorische Arbeitsteilung kann auch nach Objekten gebildet werden, wie beispielsweise<br />
Leistungen, Produkten o<strong>der</strong> Märkten, und dadurch die organisatorische Struktur<br />
bestimmen. Natürlich ist es auch möglich, dass sich Mischstrukturen aus einer <strong>Organisation</strong><br />
nach Verrichtungen und Objekten ergeben, z.B. unterschiedliche Strukturen nach Funktions-<br />
bzw. Hierarchieebenen. Erfolgt eine Objektorientierung <strong>der</strong> <strong>Organisation</strong> auf <strong>der</strong> zweitobersten<br />
Ebene, entsteht eine divisionale <strong>Organisation</strong>, die auch als Sparten- o<strong>der</strong> Geschäftsbereichsorganisation<br />
bezeichnet wird. Häufig erhalten Bereiche einer divisionalen <strong>Organisation</strong> eine<br />
weitgehende Autonomie und damit Erfolgsverantwortung, d.h. sie sollen wie ein Unternehmen<br />
im Unternehmen geführt werden (Profit-Center-Prinzip).<br />
Durch das Dezentralisierungs- und Erfolgsverantwortungsprinzip <strong>der</strong> divisionalen <strong>Organisation</strong><br />
kann die Handhabung und Bewältigung <strong>der</strong> Komplexität im Allgemeinen, aber auch im<br />
Hinblick auf <strong>Organisation</strong>sgestaltungen wesentlich erleichtert werden. In welchem Ausmaß<br />
das tatsächlich zutrifft, kann letztendlich nur in <strong>der</strong> konkreten <strong>Organisation</strong>srealität bewertet<br />
werden.<br />
Gerade bei divisionalen <strong>Organisation</strong>en bestehen häufig Zentralbereiche für die Unterstützung<br />
<strong>der</strong> Divisions bzw. Sparten bei Leitungs- und Fachfunktionen, wie Finanz- und Personalwesen,<br />
Controlling, Öffentlichkeitsarbeit, Planung u.Ä. Durch Zentralbereiche sollen regelmäßig<br />
auch Aufgaben <strong>der</strong> Gesamtkoordination erfüllt werden. Die organisatorischen Kompetenzen<br />
von Zentralbereichen sind in <strong>der</strong> Praxis unterschiedlich geregelt und gehen von Servicefunktionen<br />
bis zu Richtlinienkompetenzen.<br />
Zentralbereiche werden seit langem immer wie<strong>der</strong> stark kritisiert. Man wirft ihnen mangelndes<br />
Kostenbewusstsein vor, sie seien Verursacher einer unmäßigen Verwaltungsaufblähung,<br />
beschneiden die Sparten in ihren Möglichkeiten usw. Wie auch immer, durch Zentralbereiche<br />
kann die Komplexität, Ungewissheit und Irritation einer <strong>Organisation</strong> stark steigen. Dennoch<br />
ist vor einer Verallgemeinerung solcher Aussagen zu warnen, da es beispielsweise auch<br />
durchaus denkbar ist, dass es ohne Zentralbereiche und ihre u.a. koordinierenden Funktionen<br />
zu einer Steigerung <strong>der</strong> Komplexitätsproblematik käme. Größere divisionale <strong>Organisation</strong>en<br />
wären ohne die Dienste von Zentralbereichen kaum vorstellbar. Dass diese effizient und rationell<br />
zu erbringen sind, bedarf keines Kommentars.<br />
Eine entscheidende Voraussetzung für den Erfolg einer divisionalen <strong>Organisation</strong> und die<br />
Bewältigung <strong>der</strong> organisationalen Komplexität besteht darin, dass die verschiedenen geschäftlichen<br />
Aktivitäten in homogene und voneinan<strong>der</strong> weitgehend unabhängige Bereiche<br />
zerlegt werden, um durch zweckmäßige Bündelungen organisatorische Einheiten zu erreichen,<br />
bei denen eine getrennte Leitung und Erfolgszurechnung möglich ist. Über eine Selbststeuerung<br />
und -organisation kann dadurch die Komplexitätsproblematik erheblich reduziert<br />
werden. Ferner sind Flexibilität und Schnelligkeit durch vergleichsweise gut überschaubare<br />
82