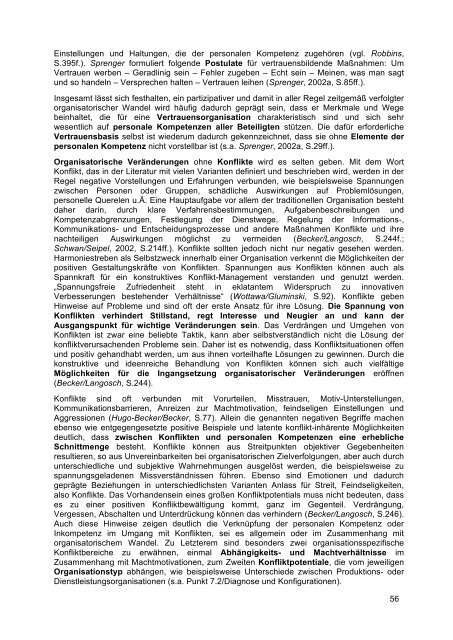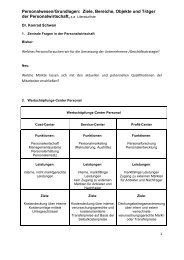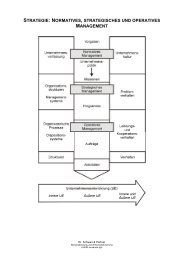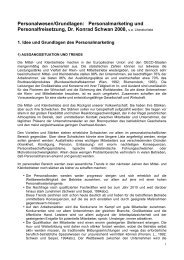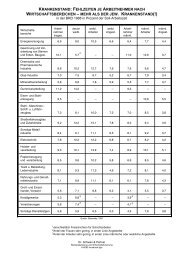Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Einstellungen und Haltungen, die <strong>der</strong> personalen Kompetenz zugehören (vgl. Robbins,<br />
S.395f.). Sprenger formuliert folgende Postulate für vertrauensbildende Maßnahmen: Um<br />
Vertrauen werben – Geradlinig sein – Fehler zugeben – Echt sein – Meinen, was man sagt<br />
und so handeln – Versprechen halten – Vertrauen leihen (Sprenger, 2002a, S.85ff.).<br />
Insgesamt lässt sich festhalten, ein partizipativer und damit in aller Regel zeitgemäß verfolgter<br />
organisatorischer <strong>Wandel</strong> wird häufig dadurch geprägt sein, dass er Merkmale und Wege<br />
beinhaltet, die für eine Vertrauensorganisation charakteristisch sind und sich sehr<br />
wesentlich auf personale Kompetenzen aller Beteiligten stützen. Die dafür erfor<strong>der</strong>liche<br />
Vertrauensbasis selbst ist wie<strong>der</strong>um dadurch gekennzeichnet, dass sie ohne Elemente <strong>der</strong><br />
personalen Kompetenz nicht vorstellbar ist (s.a. Sprenger, 2002a, S.29ff.).<br />
Organisatorische Verän<strong>der</strong>ungen ohne Konflikte wird es selten geben. Mit dem Wort<br />
Konflikt, das in <strong>der</strong> Literatur mit vielen Varianten definiert und beschrieben wird, werden in <strong>der</strong><br />
Regel negative Vorstellungen und Erfahrungen verbunden, wie beispielsweise Spannungen<br />
zwischen Personen o<strong>der</strong> Gruppen, schädliche Auswirkungen auf Problemlösungen,<br />
personelle Querelen u.Ä. Eine Hauptaufgabe vor allem <strong>der</strong> traditionellen <strong>Organisation</strong> besteht<br />
daher darin, durch klare Verfahrensbestimmungen, Aufgabenbeschreibungen und<br />
Kompetenzabgrenzungen, Festlegung <strong>der</strong> Dienstwege, Regelung <strong>der</strong> Informations-,<br />
Kommunikations- und Entscheidungsprozesse und an<strong>der</strong>e Maßnahmen Konflikte und ihre<br />
nachteiligen Auswirkungen möglichst zu vermeiden (Becker/Langosch, S.244f.;<br />
Schwan/Seipel, 2002, S.214ff.). Konflikte sollten jedoch nicht nur negativ gesehen werden.<br />
Harmoniestreben als Selbstzweck innerhalb einer <strong>Organisation</strong> verkennt die Möglichkeiten <strong>der</strong><br />
positiven Gestaltungskräfte von Konflikten. Spannungen aus Konflikten können auch als<br />
Spannkraft für ein konstruktives Konflikt-Management verstanden und genutzt werden.<br />
„Spannungsfreie Zufriedenheit steht in eklatantem Wi<strong>der</strong>spruch zu innovativen<br />
Verbesserungen bestehen<strong>der</strong> Verhältnisse“ (Wottawa/Gluminski, S.92). Konflikte geben<br />
Hinweise auf Probleme und sind oft <strong>der</strong> erste Ansatz für ihre Lösung. Die Spannung von<br />
Konflikten verhin<strong>der</strong>t Stillstand, regt Interesse und Neugier an und kann <strong>der</strong><br />
Ausgangspunkt für wichtige Verän<strong>der</strong>ungen sein. Das Verdrängen und Umgehen von<br />
Konflikten ist zwar eine beliebte Taktik, kann aber selbstverständlich nicht die Lösung <strong>der</strong><br />
konfliktverursachenden Probleme sein. Daher ist es notwendig, dass Konfliktsituationen offen<br />
und positiv gehandhabt werden, um aus ihnen vorteilhafte Lösungen zu gewinnen. Durch die<br />
konstruktive und ideenreiche Behandlung von Konflikten können sich auch vielfältige<br />
Möglichkeiten für die Ingangsetzung organisatorischer Verän<strong>der</strong>ungen eröffnen<br />
(Becker/Langosch, S.244).<br />
Konflikte sind oft verbunden mit Vorurteilen, Misstrauen, Motiv-Unterstellungen,<br />
Kommunikationsbarrieren, Anreizen zur Machtmotivation, feindseligen Einstellungen und<br />
Aggressionen (Hugo-Becker/Becker, S.77). Allein die genannten negativen Begriffe machen<br />
ebenso wie entgegengesetzte positive Beispiele und latente konflikt-inhärente Möglichkeiten<br />
deutlich, dass zwischen Konflikten und personalen Kompetenzen eine erhebliche<br />
Schnittmenge besteht. Konflikte können aus Streitpunkten objektiver Gegebenheiten<br />
resultieren, so aus Unvereinbarkeiten bei organisatorischen Zielverfolgungen, aber auch durch<br />
unterschiedliche und subjektive Wahrnehmungen ausgelöst werden, die beispielsweise zu<br />
spannungsgeladenen Missverständnissen führen. Ebenso sind Emotionen und dadurch<br />
geprägte Beziehungen in unterschiedlichsten Varianten Anlass für Streit, Feindseligkeiten,<br />
also Konflikte. Das Vorhandensein eines großen Konfliktpotentials muss nicht bedeuten, dass<br />
es zu einer positiven Konfliktbewältigung kommt, ganz im Gegenteil. Verdrängung,<br />
Vergessen, Abschalten und Unterdrückung können das verhin<strong>der</strong>n (Becker/Langosch, S.246).<br />
Auch diese Hinweise zeigen deutlich die Verknüpfung <strong>der</strong> personalen Kompetenz o<strong>der</strong><br />
Inkompetenz im Umgang mit Konflikten, sei es allgemein o<strong>der</strong> im Zusammenhang mit<br />
organisatorischem <strong>Wandel</strong>. Zu Letzterem sind beson<strong>der</strong>s zwei organisationsspezifische<br />
Konfliktbereiche zu erwähnen, einmal Abhängigkeits- und Machtverhältnisse im<br />
Zusammenhang mit Machtmotivationen, zum Zweiten Konfliktpotentiale, die vom jeweiligen<br />
<strong>Organisation</strong>styp abhängen, wie beispielsweise Unterschiede zwischen Produktions- o<strong>der</strong><br />
Dienstleistungsorganisationen (s.a. Punkt 7.2/Diagnose und Konfigurationen).<br />
56