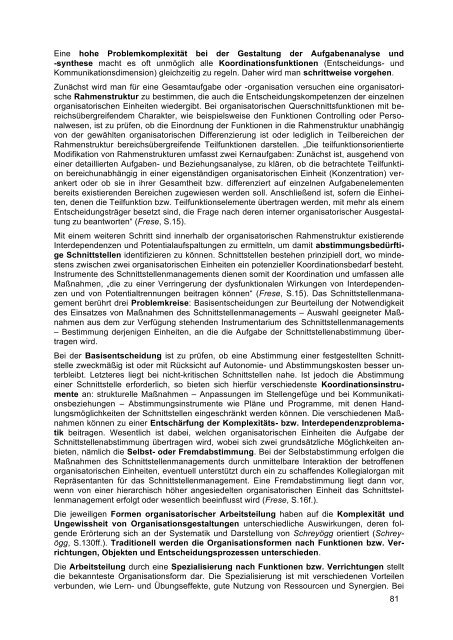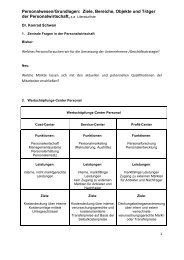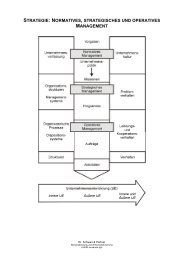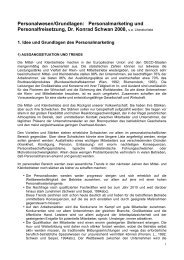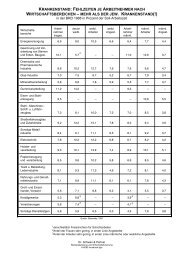Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Eine hohe Problemkomplexität bei <strong>der</strong> Gestaltung <strong>der</strong> Aufgabenanalyse und<br />
-synthese macht es oft unmöglich alle Koordinationsfunktionen (Entscheidungs- und<br />
Kommunikationsdimension) gleichzeitig zu regeln. Daher wird man schrittweise vorgehen.<br />
Zunächst wird man für eine Gesamtaufgabe o<strong>der</strong> -organisation versuchen eine organisatorische<br />
Rahmenstruktur zu bestimmen, die auch die Entscheidungskompetenzen <strong>der</strong> einzelnen<br />
organisatorischen Einheiten wie<strong>der</strong>gibt. Bei organisatorischen Querschnittsfunktionen mit bereichsübergreifendem<br />
Charakter, wie beispielsweise den Funktionen Controlling o<strong>der</strong> Personalwesen,<br />
ist zu prüfen, ob die Einordnung <strong>der</strong> Funktionen in die Rahmenstruktur unabhängig<br />
von <strong>der</strong> gewählten organisatorischen Differenzierung ist o<strong>der</strong> lediglich in Teilbereichen <strong>der</strong><br />
Rahmenstruktur bereichsübergreifende Teilfunktionen darstellen. „Die teilfunktionsorientierte<br />
Modifikation von Rahmenstrukturen umfasst zwei Kernaufgaben: Zunächst ist, ausgehend von<br />
einer detaillierten Aufgaben- und Beziehungsanalyse, zu klären, ob die betrachtete Teilfunktion<br />
bereichunabhängig in einer eigenständigen organisatorischen Einheit (Konzentration) verankert<br />
o<strong>der</strong> ob sie in ihrer Gesamtheit bzw. differenziert auf einzelnen Aufgabenelementen<br />
bereits existierenden Bereichen zugewiesen werden soll. Anschließend ist, sofern die Einheiten,<br />
denen die Teilfunktion bzw. Teilfunktionselemente übertragen werden, mit mehr als einem<br />
Entscheidungsträger besetzt sind, die Frage nach <strong>der</strong>en interner organisatorischer Ausgestaltung<br />
zu beantworten“ (Frese, S.15).<br />
Mit einem weiteren Schritt sind innerhalb <strong>der</strong> organisatorischen Rahmenstruktur existierende<br />
Interdependenzen und Potentialaufspaltungen zu ermitteln, um damit abstimmungsbedürftige<br />
Schnittstellen identifizieren zu können. Schnittstellen bestehen prinzipiell dort, wo mindestens<br />
zwischen zwei organisatorischen Einheiten ein potenzieller Koordinationsbedarf besteht.<br />
Instrumente des Schnittstellenmanagements dienen somit <strong>der</strong> Koordination und umfassen alle<br />
Maßnahmen, „die zu einer Verringerung <strong>der</strong> dysfunktionalen Wirkungen von Interdependenzen<br />
und von Potentialtrennungen beitragen können“ (Frese, S.15). Das Schnittstellenmanagement<br />
berührt drei Problemkreise: Basisentscheidungen zur Beurteilung <strong>der</strong> Notwendigkeit<br />
des Einsatzes von Maßnahmen des Schnittstellenmanagements – Auswahl geeigneter Maßnahmen<br />
aus dem zur Verfügung stehenden Instrumentarium des Schnittstellenmanagements<br />
– Bestimmung <strong>der</strong>jenigen Einheiten, an die die Aufgabe <strong>der</strong> Schnittstellenabstimmung übertragen<br />
wird.<br />
Bei <strong>der</strong> Basisentscheidung ist zu prüfen, ob eine Abstimmung einer festgestellten Schnittstelle<br />
zweckmäßig ist o<strong>der</strong> mit Rücksicht auf Autonomie- und Abstimmungskosten besser unterbleibt.<br />
Letzteres liegt bei nicht-kritischen Schnittstellen nahe. Ist jedoch die Abstimmung<br />
einer Schnittstelle erfor<strong>der</strong>lich, so bieten sich hierfür verschiedenste Koordinationsinstrumente<br />
an: strukturelle Maßnahmen – Anpassungen im Stellengefüge und bei Kommunikationsbeziehungen<br />
– Abstimmungsinstrumente wie Pläne und Programme, mit denen Handlungsmöglichkeiten<br />
<strong>der</strong> Schnittstellen eingeschränkt werden können. Die verschiedenen Maßnahmen<br />
können zu einer Entschärfung <strong>der</strong> Komplexitäts- bzw. Interdependenzproblematik<br />
beitragen. Wesentlich ist dabei, welchen organisatorischen Einheiten die Aufgabe <strong>der</strong><br />
Schnittstellenabstimmung übertragen wird, wobei sich zwei grundsätzliche Möglichkeiten anbieten,<br />
nämlich die Selbst- o<strong>der</strong> Fremdabstimmung. Bei <strong>der</strong> Selbstabstimmung erfolgen die<br />
Maßnahmen des Schnittstellenmanagements durch unmittelbare Interaktion <strong>der</strong> betroffenen<br />
organisatorischen Einheiten, eventuell unterstützt durch ein zu schaffendes Kollegialorgan mit<br />
Repräsentanten für das Schnittstellenmanagement. Eine Fremdabstimmung liegt dann vor,<br />
wenn von einer hierarchisch höher angesiedelten organisatorischen Einheit das Schnittstellenmanagement<br />
erfolgt o<strong>der</strong> wesentlich beeinflusst wird (Frese, S.16f.).<br />
Die jeweiligen Formen organisatorischer Arbeitsteilung haben auf die Komplexität und<br />
Ungewissheit von <strong>Organisation</strong>sgestaltungen unterschiedliche Auswirkungen, <strong>der</strong>en folgende<br />
Erörterung sich an <strong>der</strong> Systematik und Darstellung von Schreyögg orientiert (Schreyögg,<br />
S.130ff.). Traditionell werden die <strong>Organisation</strong>sformen nach Funktionen bzw. Verrichtungen,<br />
Objekten und Entscheidungsprozessen unterschieden.<br />
Die Arbeitsteilung durch eine Spezialisierung nach Funktionen bzw. Verrichtungen stellt<br />
die bekannteste <strong>Organisation</strong>sform dar. Die Spezialisierung ist mit verschiedenen Vorteilen<br />
verbunden, wie Lern- und Übungseffekte, gute Nutzung von Ressourcen und Synergien. Bei<br />
81