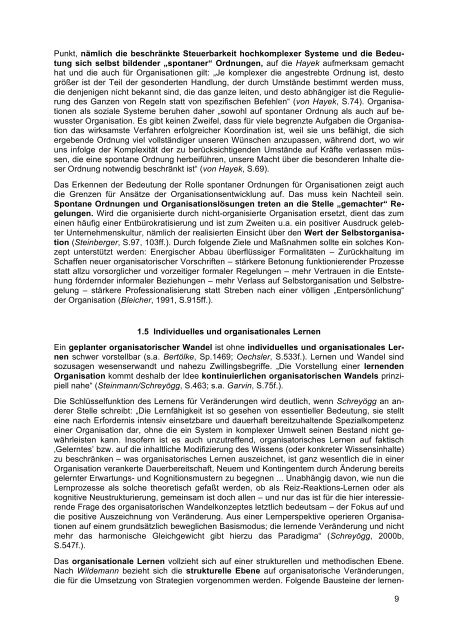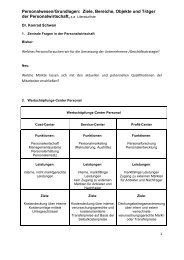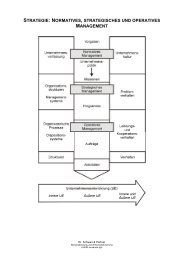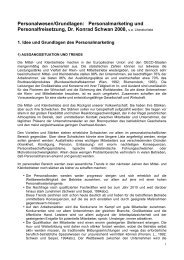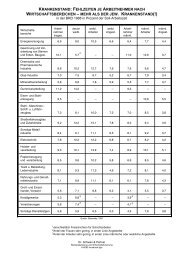Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Punkt, nämlich die beschränkte Steuerbarkeit hochkomplexer Systeme und die Bedeutung<br />
sich selbst bilden<strong>der</strong> „spontaner“ Ordnungen, auf die Hayek aufmerksam gemacht<br />
hat und die auch für <strong>Organisation</strong>en gilt: „Je komplexer die angestrebte Ordnung ist, desto<br />
größer ist <strong>der</strong> Teil <strong>der</strong> geson<strong>der</strong>ten Handlung, <strong>der</strong> durch Umstände bestimmt werden muss,<br />
die denjenigen nicht bekannt sind, die das ganze leiten, und desto abhängiger ist die Regulierung<br />
des Ganzen von Regeln statt von spezifischen Befehlen“ (von Hayek, S.74). <strong>Organisation</strong>en<br />
als soziale Systeme beruhen daher „sowohl auf spontaner Ordnung als auch auf bewusster<br />
<strong>Organisation</strong>. Es gibt keinen Zweifel, dass für viele begrenzte Aufgaben die <strong>Organisation</strong><br />
das wirksamste Verfahren erfolgreicher Koordination ist, weil sie uns befähigt, die sich<br />
ergebende Ordnung viel vollständiger unseren Wünschen anzupassen, während dort, wo wir<br />
uns infolge <strong>der</strong> Komplexität <strong>der</strong> zu berücksichtigenden Umstände auf Kräfte verlassen müssen,<br />
die eine spontane Ordnung herbeiführen, unsere Macht über die beson<strong>der</strong>en Inhalte dieser<br />
Ordnung notwendig beschränkt ist“ (von Hayek, S.69).<br />
Das Erkennen <strong>der</strong> Bedeutung <strong>der</strong> Rolle spontaner Ordnungen für <strong>Organisation</strong>en zeigt auch<br />
die Grenzen für Ansätze <strong>der</strong> <strong>Organisation</strong>sentwicklung auf. Das muss kein Nachteil sein.<br />
Spontane Ordnungen und <strong>Organisation</strong>slösungen treten an die Stelle „gemachter“ Regelungen.<br />
Wird die organisierte durch nicht-organisierte <strong>Organisation</strong> ersetzt, dient das zum<br />
einen häufig einer Entbürokratisierung und ist zum Zweiten u.a. ein positiver Ausdruck gelebter<br />
Unternehmenskultur, nämlich <strong>der</strong> realisierten Einsicht über den Wert <strong>der</strong> Selbstorganisation<br />
(Steinberger, S.97, 103ff.). Durch folgende Ziele und Maßnahmen sollte ein solches Konzept<br />
unterstützt werden: Energischer Abbau überflüssiger Formalitäten – Zurückhaltung im<br />
Schaffen neuer organisatorischer Vorschriften – stärkere Betonung funktionieren<strong>der</strong> Prozesse<br />
statt allzu vorsorglicher und vorzeitiger formaler Regelungen – mehr Vertrauen in die Entstehung<br />
för<strong>der</strong>n<strong>der</strong> informaler Beziehungen – mehr Verlass auf Selbstorganisation und Selbstregelung<br />
– stärkere Professionalisierung statt Streben nach einer völligen „Entpersönlichung“<br />
<strong>der</strong> <strong>Organisation</strong> (Bleicher, 1991, S.915ff.).<br />
1.5 Individuelles und organisationales Lernen<br />
Ein geplanter organisatorischer <strong>Wandel</strong> ist ohne individuelles und organisationales Lernen<br />
schwer vorstellbar (s.a. Bertölke, Sp.1469; Oechsler, S.533f.). Lernen und <strong>Wandel</strong> sind<br />
sozusagen wesenserwandt und nahezu Zwillingsbegriffe. „Die Vorstellung einer lernenden<br />
<strong>Organisation</strong> kommt deshalb <strong>der</strong> Idee kontinuierlichen organisatorischen <strong>Wandel</strong>s prinzipiell<br />
nahe“ (Steinmann/Schreyögg, S.463; s.a. Garvin, S.75f.).<br />
Die Schlüsselfunktion des Lernens für Verän<strong>der</strong>ungen wird deutlich, wenn Schreyögg an an<strong>der</strong>er<br />
Stelle schreibt: „Die Lernfähigkeit ist so gesehen von essentieller Bedeutung, sie stellt<br />
eine nach Erfor<strong>der</strong>nis intensiv einsetzbare und dauerhaft bereitzuhaltende Spezialkompetenz<br />
einer <strong>Organisation</strong> dar, ohne die ein System in komplexer Umwelt seinen Bestand nicht gewährleisten<br />
kann. Insofern ist es auch unzutreffend, organisatorisches Lernen auf faktisch<br />
‚Gelerntes’ bzw. auf die inhaltliche Modifizierung des Wissens (o<strong>der</strong> konkreter Wissensinhalte)<br />
zu beschränken – was organisatorisches Lernen auszeichnet, ist ganz wesentlich die in einer<br />
<strong>Organisation</strong> verankerte Dauerbereitschaft, Neuem und Kontingentem durch Än<strong>der</strong>ung bereits<br />
gelernter Erwartungs- und Kognitionsmustern zu begegnen ... Unabhängig davon, wie nun die<br />
Lernprozesse als solche theoretisch gefaßt werden, ob als Reiz-Reaktions-Lernen o<strong>der</strong> als<br />
kognitive Neustrukturierung, gemeinsam ist doch allen – und nur das ist für die hier interessierende<br />
Frage des organisatorischen <strong>Wandel</strong>konzeptes letztlich bedeutsam – <strong>der</strong> Fokus auf und<br />
die positive Auszeichnung von Verän<strong>der</strong>ung. Aus einer Lernperspektive operieren <strong>Organisation</strong>en<br />
auf einem grundsätzlich beweglichen Basismodus; die lernende Verän<strong>der</strong>ung und nicht<br />
mehr das harmonische Gleichgewicht gibt hierzu das Paradigma“ (Schreyögg, 2000b,<br />
S.547f.).<br />
Das organisationale Lernen vollzieht sich auf einer strukturellen und methodischen Ebene.<br />
Nach Wildemann bezieht sich die strukturelle Ebene auf organisatorische Verän<strong>der</strong>ungen,<br />
die für die Umsetzung von Strategien vorgenommen werden. Folgende Bausteine <strong>der</strong> lernen-<br />
9