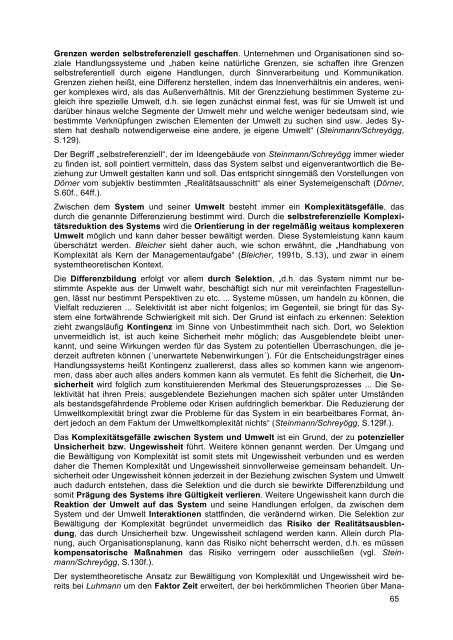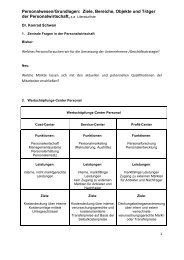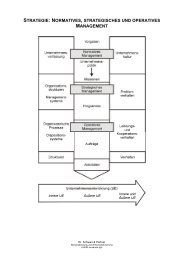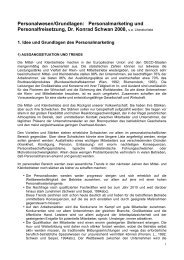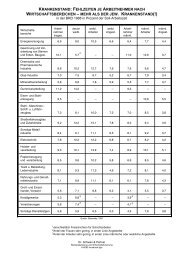Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Grenzen werden selbstreferenziell geschaffen. Unternehmen und <strong>Organisation</strong>en sind soziale<br />
Handlungssysteme und „haben keine natürliche Grenzen, sie schaffen ihre Grenzen<br />
selbstreferentiell durch eigene Handlungen, durch Sinnverarbeitung und Kommunikation.<br />
Grenzen ziehen heißt, eine Differenz herstellen, indem das Innenverhältnis ein an<strong>der</strong>es, weniger<br />
komplexes wird, als das Außenverhältnis. Mit <strong>der</strong> Grenzziehung bestimmen Systeme zugleich<br />
ihre spezielle Umwelt, d.h. sie legen zunächst einmal fest, was für sie Umwelt ist und<br />
darüber hinaus welche Segmente <strong>der</strong> Umwelt mehr und welche weniger bedeutsam sind, wie<br />
bestimmte Verknüpfungen zwischen Elementen <strong>der</strong> Umwelt zu suchen sind usw. Jedes System<br />
hat deshalb notwendigerweise eine an<strong>der</strong>e, je eigene Umwelt“ (Steinmann/Schreyögg,<br />
S.129).<br />
Der Begriff „selbstreferenziell“, <strong>der</strong> im Ideengebäude von Steinmann/Schreyögg immer wie<strong>der</strong><br />
zu finden ist, soll pointiert vermitteln, dass das System selbst und eigenverantwortlich die Beziehung<br />
zur Umwelt gestalten kann und soll. Das entspricht sinngemäß den Vorstellungen von<br />
Dörner vom subjektiv bestimmten „Realitätsausschnitt“ als einer Systemeigenschaft (Dörner,<br />
S.60f., 64ff.).<br />
Zwischen dem System und seiner Umwelt besteht immer ein Komplexitätsgefälle, das<br />
durch die genannte Differenzierung bestimmt wird. Durch die selbstreferenzielle Komplexitätsreduktion<br />
des Systems wird die Orientierung in <strong>der</strong> regelmäßig weitaus komplexeren<br />
Umwelt möglich und kann daher besser bewältigt werden. Diese Systemleistung kann kaum<br />
überschätzt werden. Bleicher sieht daher auch, wie schon erwähnt, die „Handhabung von<br />
Komplexität als Kern <strong>der</strong> Managementaufgabe“ (Bleicher, 1991b, S.13), und zwar in einem<br />
systemtheoretischen Kontext.<br />
Die Differenzbildung erfolgt vor allem durch Selektion, „d.h. das System nimmt nur bestimmte<br />
Aspekte aus <strong>der</strong> Umwelt wahr, beschäftigt sich nur mit vereinfachten Fragestellungen,<br />
lässt nur bestimmt Perspektiven zu etc. ... Systeme müssen, um handeln zu können, die<br />
Vielfalt reduzieren ... Selektivität ist aber nicht folgenlos; im Gegenteil, sie bringt für das System<br />
eine fortwährende Schwierigkeit mit sich. Der Grund ist einfach zu erkennen: Selektion<br />
zieht zwangsläufig Kontingenz im Sinne von Unbestimmtheit nach sich. Dort, wo Selektion<br />
unvermeidlich ist, ist auch keine Sicherheit mehr möglich; das Ausgeblendete bleibt unerkannt,<br />
und seine Wirkungen werden für das System zu potentiellen Überraschungen, die je<strong>der</strong>zeit<br />
auftreten können (´unerwartete Nebenwirkungen´). Für die Entscheidungsträger eines<br />
Handlungssystems heißt Kontingenz zuallererst, dass alles so kommen kann wie angenommen,<br />
dass aber auch alles an<strong>der</strong>s kommen kann als vermutet. Es fehlt die Sicherheit, die Unsicherheit<br />
wird folglich zum konstituierenden Merkmal des Steuerungsprozesses ... Die Selektivität<br />
hat ihren Preis; ausgeblendete Beziehungen machen sich später unter Umständen<br />
als bestandsgefährdende Probleme o<strong>der</strong> Krisen aufdringlich bemerkbar. Die Reduzierung <strong>der</strong><br />
Umweltkomplexität bringt zwar die Probleme für das System in ein bearbeitbares Format, än<strong>der</strong>t<br />
jedoch an dem Faktum <strong>der</strong> Umweltkomplexität nichts“ (Steinmann/Schreyögg, S.129f.).<br />
Das Komplexitätsgefälle zwischen System und Umwelt ist ein Grund, <strong>der</strong> zu potenzieller<br />
Unsicherheit bzw. Ungewissheit führt. Weitere können genannt werden. Der Umgang und<br />
die Bewältigung von Komplexität ist somit stets mit Ungewissheit verbunden und es werden<br />
daher die Themen Komplexität und Ungewissheit sinnvollerweise gemeinsam behandelt. Unsicherheit<br />
o<strong>der</strong> Ungewissheit können je<strong>der</strong>zeit in <strong>der</strong> Beziehung zwischen System und Umwelt<br />
auch dadurch entstehen, dass die Selektion und die durch sie bewirkte Differenzbildung und<br />
somit Prägung des Systems ihre Gültigkeit verlieren. Weitere Ungewissheit kann durch die<br />
Reaktion <strong>der</strong> Umwelt auf das System und seine Handlungen erfolgen, da zwischen dem<br />
System und <strong>der</strong> Umwelt Interaktionen stattfinden, die verän<strong>der</strong>nd wirken. Die Selektion zur<br />
Bewältigung <strong>der</strong> Komplexität begründet unvermeidlich das Risiko <strong>der</strong> Realitätsausblendung,<br />
das durch Unsicherheit bzw. Ungewissheit schlagend werden kann. Allein durch Planung,<br />
auch <strong>Organisation</strong>splanung, kann das Risiko nicht beherrscht werden, d.h. es müssen<br />
kompensatorische Maßnahmen das Risiko verringern o<strong>der</strong> ausschließen (vgl. Steinmann/Schreyögg,<br />
S.130f.).<br />
Der systemtheoretische Ansatz zur Bewältigung von Komplexität und Ungewissheit wird bereits<br />
bei Luhmann um den Faktor Zeit erweitert, <strong>der</strong> bei herkömmlichen Theorien über Mana-<br />
65