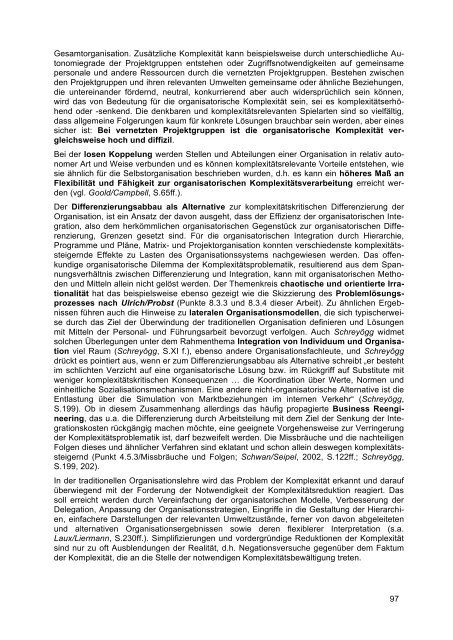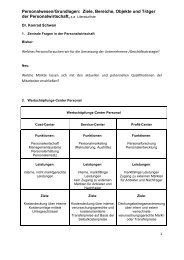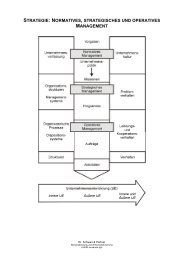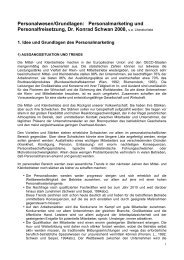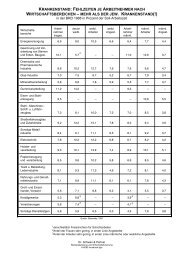Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Organisationsgrundlagen: Wandel der Organisation
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Gesamtorganisation. Zusätzliche Komplexität kann beispielsweise durch unterschiedliche Autonomiegrade<br />
<strong>der</strong> Projektgruppen entstehen o<strong>der</strong> Zugriffsnotwendigkeiten auf gemeinsame<br />
personale und an<strong>der</strong>e Ressourcen durch die vernetzten Projektgruppen. Bestehen zwischen<br />
den Projektgruppen und ihren relevanten Umwelten gemeinsame o<strong>der</strong> ähnliche Beziehungen,<br />
die untereinan<strong>der</strong> för<strong>der</strong>nd, neutral, konkurrierend aber auch wi<strong>der</strong>sprüchlich sein können,<br />
wird das von Bedeutung für die organisatorische Komplexität sein, sei es komplexitätserhöhend<br />
o<strong>der</strong> -senkend. Die denkbaren und komplexitätsrelevanten Spielarten sind so vielfältig,<br />
dass allgemeine Folgerungen kaum für konkrete Lösungen brauchbar sein werden, aber eines<br />
sicher ist: Bei vernetzten Projektgruppen ist die organisatorische Komplexität vergleichsweise<br />
hoch und diffizil.<br />
Bei <strong>der</strong> losen Koppelung werden Stellen und Abteilungen einer <strong>Organisation</strong> in relativ autonomer<br />
Art und Weise verbunden und es können komplexitätsrelevante Vorteile entstehen, wie<br />
sie ähnlich für die Selbstorganisation beschrieben wurden, d.h. es kann ein höheres Maß an<br />
Flexibilität und Fähigkeit zur organisatorischen Komplexitätsverarbeitung erreicht werden<br />
(vgl. Goold/Campbell, S.65ff.).<br />
Der Differenzierungsabbau als Alternative zur komplexitätskritischen Differenzierung <strong>der</strong><br />
<strong>Organisation</strong>, ist ein Ansatz <strong>der</strong> davon ausgeht, dass <strong>der</strong> Effizienz <strong>der</strong> organisatorischen Integration,<br />
also dem herkömmlichen organisatorischen Gegenstück zur organisatorischen Differenzierung,<br />
Grenzen gesetzt sind. Für die organisatorischen Integration durch Hierarchie,<br />
Programme und Pläne, Matrix- und Projektorganisation konnten verschiedenste komplexitätssteigernde<br />
Effekte zu Lasten des <strong>Organisation</strong>ssystems nachgewiesen werden. Das offenkundige<br />
organisatorische Dilemma <strong>der</strong> Komplexitätsproblematik, resultierend aus dem Spannungsverhältnis<br />
zwischen Differenzierung und Integration, kann mit organisatorischen Methoden<br />
und Mitteln allein nicht gelöst werden. Der Themenkreis chaotische und orientierte Irrationalität<br />
hat das beispielsweise ebenso gezeigt wie die Skizzierung des Problemlösungsprozesses<br />
nach Ulrich/Probst (Punkte 8.3.3 und 8.3.4 dieser Arbeit). Zu ähnlichen Ergebnissen<br />
führen auch die Hinweise zu lateralen <strong>Organisation</strong>smodellen, die sich typischerweise<br />
durch das Ziel <strong>der</strong> Überwindung <strong>der</strong> traditionellen <strong>Organisation</strong> definieren und Lösungen<br />
mit Mitteln <strong>der</strong> Personal- und Führungsarbeit bevorzugt verfolgen. Auch Schreyögg widmet<br />
solchen Überlegungen unter dem Rahmenthema Integration von Individuum und <strong>Organisation</strong><br />
viel Raum (Schreyögg, S.XI f.), ebenso an<strong>der</strong>e <strong>Organisation</strong>sfachleute, und Schreyögg<br />
drückt es pointiert aus, wenn er zum Differenzierungsabbau als Alternative schreibt „er besteht<br />
im schlichten Verzicht auf eine organisatorische Lösung bzw. im Rückgriff auf Substitute mit<br />
weniger komplexitätskritischen Konsequenzen … die Koordination über Werte, Normen und<br />
einheitliche Sozialisationsmechanismen. Eine an<strong>der</strong>e nicht-organisatorische Alternative ist die<br />
Entlastung über die Simulation von Marktbeziehungen im internen Verkehr“ (Schreyögg,<br />
S.199). Ob in diesem Zusammenhang allerdings das häufig propagierte Business Reengineering,<br />
das u.a. die Differenzierung durch Arbeitsteilung mit dem Ziel <strong>der</strong> Senkung <strong>der</strong> Integrationskosten<br />
rückgängig machen möchte, eine geeignete Vorgehensweise zur Verringerung<br />
<strong>der</strong> Komplexitätsproblematik ist, darf bezweifelt werden. Die Missbräuche und die nachteiligen<br />
Folgen dieses und ähnlicher Verfahren sind eklatant und schon allein deswegen komplexitätssteigernd<br />
(Punkt 4.5.3/Missbräuche und Folgen; Schwan/Seipel, 2002, S.122ff.; Schreyögg,<br />
S.199, 202).<br />
In <strong>der</strong> traditionellen <strong>Organisation</strong>slehre wird das Problem <strong>der</strong> Komplexität erkannt und darauf<br />
überwiegend mit <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Notwendigkeit <strong>der</strong> Komplexitätsreduktion reagiert. Das<br />
soll erreicht werden durch Vereinfachung <strong>der</strong> organisatorischen Modelle, Verbesserung <strong>der</strong><br />
Delegation, Anpassung <strong>der</strong> <strong>Organisation</strong>sstrategien, Eingriffe in die Gestaltung <strong>der</strong> Hierarchien,<br />
einfachere Darstellungen <strong>der</strong> relevanten Umweltzustände, ferner von davon abgeleiteten<br />
und alternativen <strong>Organisation</strong>sergebnissen sowie <strong>der</strong>en flexiblerer Interpretation (s.a.<br />
Laux/Liermann, S.230ff.). Simplifizierungen und vor<strong>der</strong>gründige Reduktionen <strong>der</strong> Komplexität<br />
sind nur zu oft Ausblendungen <strong>der</strong> Realität, d.h. Negationsversuche gegenüber dem Faktum<br />
<strong>der</strong> Komplexität, die an die Stelle <strong>der</strong> notwendigen Komplexitätsbewältigung treten.<br />
97