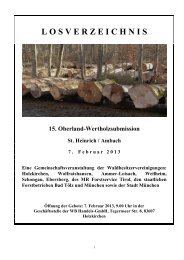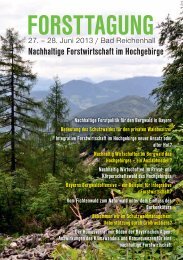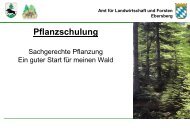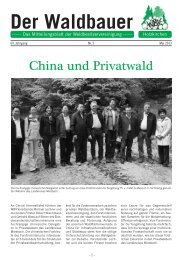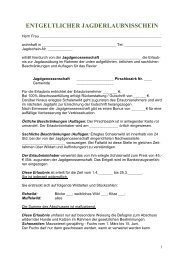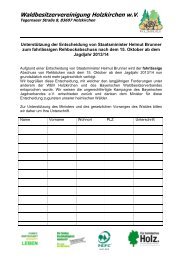Gutachten zum Wald-Wild-Konflikt
Gutachten zum Wald-Wild-Konflikt
Gutachten zum Wald-Wild-Konflikt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
fördert. Nach dem 1. Weltkrieg waren die <strong>Wild</strong>bestände durch von der hungernden<br />
Bevölkerung zunächst vermehrt ausgeübte <strong>Wild</strong>erei relativ niedrig. Sogar seltene<br />
und verbissgefährdete Baumarten wie die Elsbeere konnten sich in dieser Zeit auf<br />
geeigneten Standorten in der Verjüngung etablieren (Kahle 2004). Mit dem Wachsen<br />
der Städte und dem Auftreten großer Kalamitäten in den Nadelbaummonokulturen<br />
trat im Hinblick auf die Ansprüche an den <strong>Wald</strong> ein Gesinnungswandel ein. Neben<br />
der Nutzfunktion des <strong>Wald</strong>es wurden auch dessen Schutz- und Erholungsfunktion<br />
erkannt. Die großen Reparationshiebe der Siegermächte erforderten allerdings wieder<br />
großflächige Aufforstungen. Diese Flächen wurden in der Regel erneut mit Fichten<br />
und Kiefern aufgeforstet. Bis 1933 war die Pacht kleinerer Jagden möglich, in<br />
denen in erster Linie <strong>zum</strong> <strong>Wild</strong>breterwerb gejagt wurde. Mit der Machtübernahme der<br />
Nationalsozialisten folgten eine Aufwertung der Trophäenjagd und die Einführung<br />
strenger Hegerichtlinien. Die <strong>Wild</strong>bestände und damit die Schäden im <strong>Wald</strong> stiegen<br />
wieder an. Die Hege der <strong>Wild</strong>bestände ging so weit, dass im Winter 1942/43 Hafer<br />
zur <strong>Wild</strong>fütterung an die Staatsjagdreviere abgeliefert werden musste, ohne Rücksicht<br />
auf die hungernde Bevölkerung. Die letzten großen Beutegreifer (Bär, Wolf,<br />
Luchs) waren als Nahrungs- und Jagdkonkurrenten schon seit langem ausgerottet<br />
worden, so dass einer ungehinderten Vermehrung des <strong>Wild</strong>es nichts im Wege stand.<br />
Immer wieder durchstreifende Großräuber wurden rasch erlegt (z.B. 17 Wölfe in der<br />
DDR nach 1945, 7 Wölfe in der Bundesrepublik Deutschland bis 1975, Rösener<br />
2004).<br />
Nach dem 2. Weltkrieg mussten erneut großflächige Reparationshiebe geleistet werden<br />
(Sommer 2005). Außerdem war der Bedarf an Bau- und Brennholz groß. Die zur<br />
Befriedigung dieser Bedürfnisse vielerorts übliche und einfache<br />
Kahlschlagswirtschaft führte zu einer Konzentration des <strong>Wild</strong>es auf den<br />
Kahlschlagsflächen, und der ohne Zaunschutz praktisch unmöglich gewordenen Verjüngung<br />
von Laubbaumarten und der Weißtanne. Aufwendige und teure Einzelschutzverfahren<br />
wurden getestet, aber bald wieder aufgrund mangelnder Wirksamkeit<br />
aufgegeben. Viele <strong>Wald</strong>besitzer pflanzten deshalb weiterhin die relativ<br />
verbisstoleranten Fichten und Kiefern. Schon 1951 gingen Förster davon aus, dass<br />
der Schaden im <strong>Wald</strong> durch <strong>Wild</strong>verbiss zehnmal so hoch war wie der durch Sturm<br />
und andere Naturkatastrophen verursachte (Meister und Offenberger 2004). Initiativen,<br />
die sich für einen gestuften <strong>Wald</strong>aufbau und Mischbestände mit geringeren<br />
<strong>Wild</strong>beständen einsetzten (z.B. Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße <strong>Wald</strong>wirtschaft<br />
11