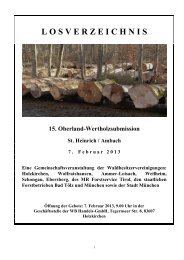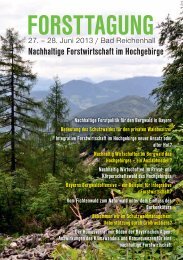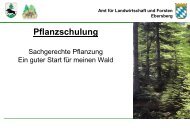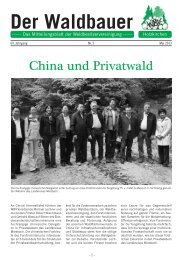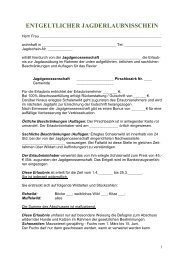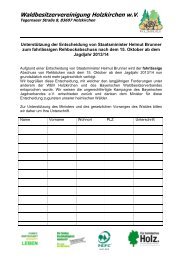Gutachten zum Wald-Wild-Konflikt
Gutachten zum Wald-Wild-Konflikt
Gutachten zum Wald-Wild-Konflikt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4.2.4 Bodenfruchtbarkeit<br />
Analog zu Untersuchungen in Nordamerika, bei denen nachgewiesen wurde, dass<br />
hohe Schalenwilddichten zu Nährstoffverlusten im Boden führen (Singer und Schoenecker<br />
2003), konnte auch in einer Untersuchung an vier Standorten der<br />
Hauptdolomitzone der bayerischen Kalkalpen gezeigt werden, dass die langanhaltende<br />
Verhinderung von Biomassenallokation der Holzgewächse durch Schalenwildverbiss<br />
zu einer nachweisbaren Verringerung der Bodenfruchtbarkeit führt (Prietzel<br />
und Ammer 2008). So waren die Humusakkumulation sowie die Vorräte und die Versorgung<br />
des Jungwuchses mit den limitierenden Nährstoffen N, P und K auf seit ca.<br />
30 Jahren gezäunten Versuchsflächen höher bzw. besser als auf benachbarten<br />
ungezäunten Vergleichsparzellen. Auch wenn entsprechende Ergebnisse an anderen<br />
Standorten wegen der unterschiedlichen klimatisch-standörtlichen Rahmenbedingungen<br />
und dem Fehlen von Erosion und Schneeschurf nicht in der selben Deutlichkeit<br />
zu finden sind, ist bei ähnlichen Untersuchungen von den meisten Autoren<br />
ohne Schalenwildverbiss ebenfalls eine Erhöhung des Humus- und Stickstoffvorrates<br />
und ein verbesserter Nährstoffumlauf berichtet worden (vgl. z. B. Binkley et al. 2003;<br />
Harrison and Bardgett 2004). In diesem Zusammenhang kommt der ungestörten<br />
Entwicklung des Jungwuchses als Streulieferant eine besondere Bedeutung zu. Effekte<br />
auf die Bodenfruchtbarkeit sind allerdings erst bei langanhaltendem und entsprechend<br />
schwerem Verbiss zu beobachten (Carline und Bardgett 2005). Eine vermutlich<br />
lange Zeit irreparable Bodendegradation durch hohe Rotwilddichten auf Luvseitigen<br />
Hängen beschrieben auch Mohr und Topp (2001). Sie fanden bei Untersuchungen<br />
im Rheinischen Schiefergebirge heraus, dass sich die durch das <strong>Wild</strong> bedingte<br />
Bodenstörung signifikant negativ auf bodenchemische und mikrobielle Kenngrößen<br />
auswirkte.<br />
4.3 Auswirkungen auf Schutzwälder<br />
Die Hauptfunktion eines Schutzwaldes ist der Schutz von Menschen, Gütern und Infrastrukturen<br />
vor Naturgefahren. Wälder entfalten Schutzwirkungen gegenüber Lawinen,<br />
Steinschlag, Rutschungen, Muren, Starkregenereignissen und anderen Erosionsprozessen<br />
(Brang et al. 2006, 2007). Entsprechend groß sind seit langem die<br />
Bemühungen vor allem in den Gebirgswäldern, die Schutzwirkungen durch waldbauliche<br />
Eingriffe und erforderlichenfalls durch Sanierungsmaßnahmen zu sichern. Ausgehend<br />
von der Erkenntnis, dass Mischbestände in den mittleren Gebirgslagen (um<br />
1000 m) hochproduktiv und - wie alle Klimaxgesellschaften (Clements 1936) - aus-<br />
72