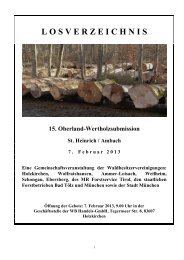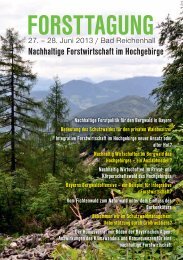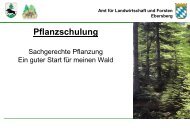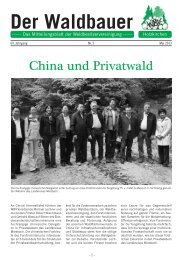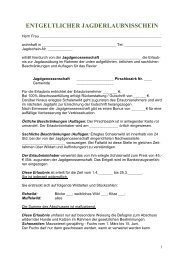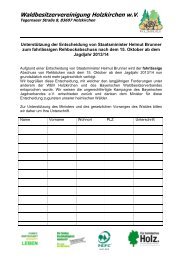Gutachten zum Wald-Wild-Konflikt
Gutachten zum Wald-Wild-Konflikt
Gutachten zum Wald-Wild-Konflikt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4.2.2 Bodenvegetation<br />
Die Wirkungen von Verbiss an Sträuchern, Kräutern und gelegentlich auch Gräsern<br />
ähneln denen an Bäumen. So findet auch innerhalb der Bodenvegetation eine Verschiebung<br />
der Konkurrenzverhältnisse zulasten besonders häufig verbissener Arten,<br />
wie z. B. der Brombeere, der Besenheide, und der <strong>Wald</strong>heckenkirsche, und ein<br />
Rückgang der Biomasse bzw. des Deckungsgrades solcher Arten statt (González<br />
Hernández und Silva-Pando 1996). Häufig werden dadurch Gräser wie die beiden<br />
Honiggräser oder die Drahtschmiele begünstigt (Kirby 2001). Entsprechend fand<br />
Mosandl (1991) auf einem Kahlschlag außerhalb von Zäunen etwa 10 Jahre nach<br />
dem Hieb heraus, dass die Biomasse der Bodenvegetation 2,21 Tonnen/ha ausmachte<br />
und dass 51,5 % dieses Wertes von Gräsern gebildet wurde. Innerhalb der<br />
Zäune überwog dagegen die Gehölzverjüngung. Als Folge davon betrug die Biomasse<br />
der Bodenvegetation lediglich 0,83 Tonnen/ha, von denen die Grasarten nur 19,3<br />
% einnahmen. Da starker <strong>Wild</strong>verbiss zulasten einer beschattenden Strauch- und<br />
Verjüngungsschicht geht, profitieren Arten wie z. B. das Buschwindröschen, das auf<br />
Beschattung empfindlich reagiert (Watkinson et al. 2001). Inwieweit <strong>Wild</strong>verbiss zu<br />
einer Florenverarmung oder zu einer höheren Diversität der Bodenpflanzen führt,<br />
kann aufgrund der unterschiedlichen Ansprüche der Arten nicht abschließend geklärt<br />
werden. Für beide Erscheinungen lassen sich zahlreiche Belege finden (Putman<br />
1996, Joys et al. 2004). So scheinen hierbei neben der Ökologie der Arten die Produktivität<br />
des Standorts und der Verbissdruck eine große Rolle zu spielen (Horsley et<br />
al. 2003, Vavra et. al. 2007). Welchen Beitrag hohe <strong>Wild</strong>dichten neben der Beweidung<br />
durch Nutzvieh <strong>zum</strong> Offenhalten von parkartigen Strukturen leisten, ist wenig<br />
untersucht (Putman 1996). Im Auftrag der Stiftung natur+mensch wurde unlängst eine<br />
Pilotstudie <strong>zum</strong> Thema „<strong>Wild</strong> + Biologische Vielfalt“ angefertigt (Reck 2009). Diese<br />
kommt <strong>zum</strong> Schluss, dass eine Erhöhung der Schalenwilddichte lokal eine Erhöhung<br />
der Biodiversität verursachen kann. Diese Schlussfolgerung (tatsächlich sind<br />
durch besonders hohe Rotwilddichten offengehaltene Truppenübungsplätze reich an<br />
seltenen Tier- und Pflanzenarten, s.a. 4.2.3) ist im Hinblick auf die <strong>Wald</strong>bewirtschaftung<br />
allerdings ohne Belang, denn dort ist eine maximale Artendiversität nicht das<br />
Ziel. Selbst wenn dem so wäre würde im <strong>Wald</strong> das Interesse einer Diversität der typischen<br />
<strong>Wald</strong>arten gelten und nicht der in der Tat großen Diversität naturferner Lebensräume,<br />
die langfristig nur durch andauernden anthropogenen Einfluss erhalten<br />
werden kann (z.B. Magerrasen, Heiden).<br />
69