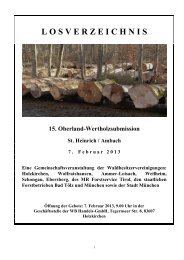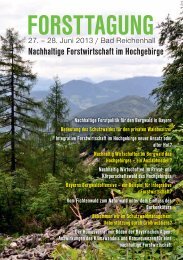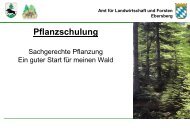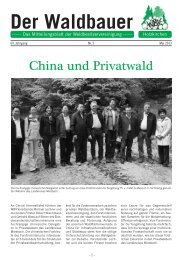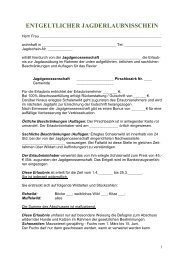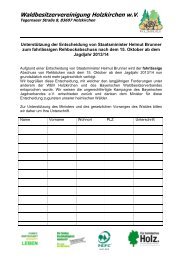Gutachten zum Wald-Wild-Konflikt
Gutachten zum Wald-Wild-Konflikt
Gutachten zum Wald-Wild-Konflikt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
würde sich dort niemand präsentieren. Es ist daher notwendig, die Jagd auf bestimmte<br />
Tierarten anhand von objektiv bewertbaren Kriterien (z.B. <strong>Wild</strong>schäden)<br />
auszurichten. Diese Art der Jagdausübung könnte von einer selbstkritischen<br />
Jagdpresse transparent und ohne das zwanghafte Suchen nach Rechtfertigungsgründen<br />
vertreten werden. Zu einem verantwortungsvollen Umgang mit<br />
<strong>Wild</strong>tieren gehört aber auch (selbst bei Arten, die Schäden verursachen oder andere<br />
„beliebtere“ Arten dezimieren), dass die Jagd unterbleibt, wenn diese Tiere<br />
in ihrem Bestand bedroht sind. Ein entsprechendes Verbot kann lokal, regional<br />
und überregional ausgesprochen werden und sollte auf die Reproduktionsstrategien<br />
und Wanderungsmöglichkeiten der jeweiligen Arten abgestimmt sein. Ein<br />
gutes Beispiel hierfür bietet das Rotwild, das örtlich in anthropogen bedingt zu<br />
hohen Dichten vorkommt und andererseits in Regionen abwesend ist, die durchaus<br />
für kleine Populationen geeignet wären. Nicht förderlich sind Statements, die<br />
als Aufruf zur Ausrottung von Schalenwildarten missgedeutet werden können.<br />
Der <strong>Wald</strong>-<strong>Wild</strong>-<strong>Konflikt</strong> lässt sich damit nicht lösen, da sich so wieder Gegenpositionen<br />
aufbauen, die nicht zu einer Verbesserung der Gesamtsituation beitragen.<br />
Zur Bewusstseinsförderung von negativen Auswirkungen zu hoher Schalenwildbestände<br />
sollten Vertreter von Forstbetrieben an der Ausbildung und Weiterbildung<br />
von Jägern beteiligt werden.<br />
• <strong>Wild</strong>biologische Erfordernisse der vorkommenden <strong>Wild</strong>arten stärker beachten.<br />
Populationsdichten nicht „künstlich“ anheben. Schwarzwildkirrungen stark einschränken.<br />
Fütterungen ohne konkreten Nachweis für ihre Notwendigkeit verbieten.<br />
Wirkliche Notzeiten (z.B. durch sehr hohe Schneelagen oder stark verharschten<br />
Dauerschnee im Winter) sind selten, bei ausreichend Ruhe und Wanderungsmöglichkeiten<br />
ist das <strong>Wild</strong> auf normale Winter und die damit verbundene<br />
Schneelage eingestellt. Eine Abwendung von <strong>Wild</strong>schäden durch Winterfütterung<br />
konnte nicht wissenschaftlich nachgewiesen werden (Wölfel 1999). Dies trifft<br />
nicht nur für Rotwild, sondern auch für Rehwild zu (Zeiler 2009). Gleiches gilt für<br />
künstlich geschaffene Äsungsflächen, die, <strong>zum</strong>indest was das Rehwild angeht,<br />
vollkommen zwecklos sind (Hespeler 2010). In der Umgebung von nicht sachgemäß<br />
angelegten Rotwildfütterungen (z.B. nur ein Trog für viele Tiere, falsches<br />
Futter) kommt es sogar zu erhöhten Schälschäden, z.B. durch rangniedere Tiere,<br />
deren Zugang zu den Fütterungen durch ranghöhere Tiere unterbunden wird<br />
(Wölfel 1999). Zur Schaffung von Winterruhezonen und Wanderungsmöglichkei-<br />
133