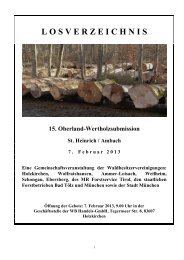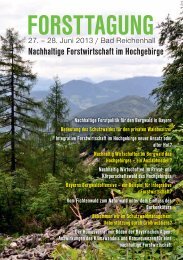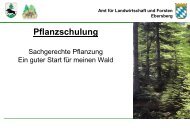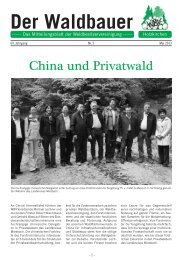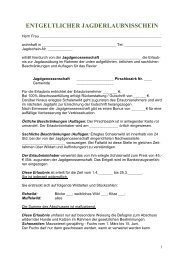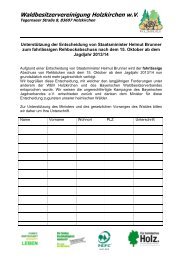Gutachten zum Wald-Wild-Konflikt
Gutachten zum Wald-Wild-Konflikt
Gutachten zum Wald-Wild-Konflikt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
- artgerechtere und effektivere Jagdmethoden unter Verkürzung der Jagdzeiten<br />
und Schaffung von Anreizen für die Jägerinnen und Jäger,<br />
- ein Fütterungsverbot mit Ausnahme von öffentlich bekanntgegebenen Notzeiten,<br />
- stärkere Kontrolle der Kirrjagd,<br />
- die Förderung und Akzeptanz von Großraubwild, sowie<br />
- den Verzicht auf Anrechnung von Unfallwild auf Abschusspläne.<br />
4. Kalkulation der betrieblichen und volkswirtschaftlichen Folgen von Schäden<br />
durch Schalenwild im <strong>Wald</strong> und Kommunikation der Ergebnisse an die Politik.<br />
5. Einführung eines möglichst bundeseinheitlichen Verfahrens zur Durchführung<br />
von Verjüngungs-, Schälschadens- und Verbissinventuren. Für die statistische<br />
Absicherung der Ergebnisse ist die Einführung von Vertrauensgrenzen, für die<br />
praktische Beurteilung eine Ableitung kritischer Intensitäten sinnvoll.<br />
6. Der <strong>Wald</strong>-<strong>Wild</strong>-<strong>Konflikt</strong> hat wegen der damit verbundenen rechtlichen, ökologischen,<br />
volks- und betriebswirtschaftlichen Implikationen erhebliche gesellschaftliche<br />
Relevanz und sollte deshalb gerade auch auf hoher politischer Ebene behandelt<br />
werden.<br />
Die folgende Darstellung befasst sich mit der Frage, wie die in den einschlägigen<br />
Gesetzesvorschriften (vgl. Kapitel 3) genannten Ziele unter besonderer Berücksichtigung<br />
der Defizite in der Umsetzung bestehender Gesetze (vgl. Kapitel 6) erreicht<br />
werden könnten. In diesem Zusammenhang sind zwei Hinweise von Bedeutung.<br />
Zum Einen spiegeln die genannten Ziele lediglich den derzeitigen Stand der gesellschaftlichen<br />
Diskussion wieder. Da sich die Anforderungen künftiger Generationen<br />
an Wälder unter Umständen aber verschieben, diese jedoch nur über Jahrzehnte<br />
verändert werden können, sind vor allem solche Lösungsmöglichkeiten von Interesse,<br />
die die Entwicklung vielgestaltiger, d. h. in Richtung verschiedener Bedürfnisse<br />
hin entwickelbarer Wälder (vgl. Wagner 2007) gewährleisten. Da die Ziele der <strong>Wald</strong>entwicklung<br />
durch den Gesetzgeber vorgegeben sind, ist hier die Diskussion um die<br />
Frage, welchem Verbiss <strong>Wald</strong>verjüngungen in Urwäldern ausgesetzt waren, nicht<br />
von Belang. Aus diesem Grund spielt bei der hier erfolgten Darstellung des<br />
Sachstandes weder die Megaherbivorentheorie, nach der Mitteleuropa eher einer offenen<br />
Parklandschaft als einem geschlossenen <strong>Wald</strong> geglichen haben soll (vgl.<br />
Bengtsson et al. 2000), noch die gelegentlich vertretene Meinung, ein hoher Anteil<br />
verbissener Bäumchen sei natürlich, eine Rolle. Abgesehen von dem Umstand, dass<br />
beides rückblickend nicht widerspruchsfrei belegbar ist, stehen hier die derzeit an<br />
116