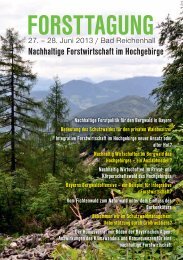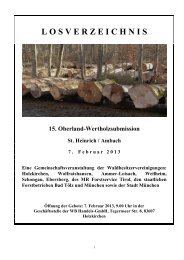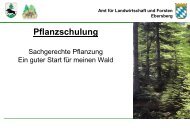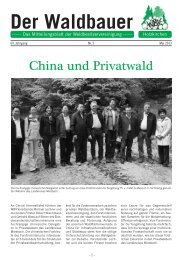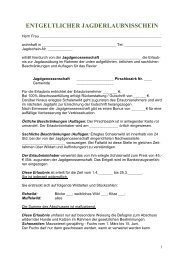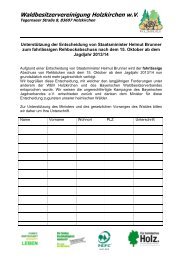Gutachten zum Wald-Wild-Konflikt
Gutachten zum Wald-Wild-Konflikt
Gutachten zum Wald-Wild-Konflikt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
7.2 <strong>Wald</strong>bauliche, wildbiologische und jagdtechnische Lösungsan-<br />
sätze<br />
7.2.1 <strong>Wald</strong>bauliche Lösungsansätze<br />
Mit Blick auf die in Abschnitt 4.1.5 dargestellten Befunde dürfen die waldbaulichen<br />
Möglichkeiten, Verbissschäden zu vermeiden, insbesondere bei hohen <strong>Wild</strong>dichten<br />
nicht überschätzt werden. Die in den vergangenen Jahrzehnten in Gang gebrachten<br />
<strong>Wald</strong>bauprogramme bei der Staatswaldbewirtschaftung und auch die Veränderungen<br />
in der Bewirtschaftung von Privatwäldern haben vielerorts zu einer Verbesserung der<br />
Lebensgrundlagen für das Schalenwild geführt. Ein vielfältiges Nahrungsangebot<br />
kann aber nur dann helfen, Schäden zu vermeiden, wenn die Schalenwilddichten<br />
niedrig sind (vgl. Kapitel 4.1.5). Ist dies der Fall, kann die aus ökologischen und ökonomischen<br />
Gründen gewollte Diversität der <strong>Wald</strong>bestände hinsichtlich ihrer Struktur<br />
und ihrer Baumartenzusammensetzung erhalten bzw. gesteigert werden. Aus der<br />
<strong>zum</strong>eist geplanten vorwiegend einzelstammweisen Nutzung von Bäumen können<br />
sich allerdings Probleme für lichtbedürftige Baumarten ergeben. Diese liegen in der<br />
im Vergleich zu schattentoleranteren Arten geringeren Konkurrenzkraft und in der<br />
längeren Gefährdung durch Schalenwild im Verjüngungsstadium durch ein unter ungünstigen<br />
Lichtverhältnissen langsameres Wachstum. Ein wichtiger waldbaulicher<br />
Lösungsansatz, diese Baumarten ebenfalls angemessen zu beteiligen, besteht daher<br />
in der konkreten Förderung einzelner (insbesondere seltener) Baumarten durch Beachtung<br />
ihrer Ansprüche an den Boden und an die Strahlungsbedingungen. Dies bedeutet,<br />
dass auch Verjüngungs- und Ernteverfahren in Frage kommen, die das Überleben<br />
und ein rasches Jugendwachstum der lichtbedürftigen Baumarten gewährleisten.<br />
Mitunter wird dadurch die krautige Vegetation ebenfalls gefördert, was bei niedrigen<br />
Schalenwilddichten <strong>zum</strong>indest teilweise den Verbissdruck auf die Baumverjüngung<br />
reduzieren kann.<br />
Zu vermeiden sind allerdings großflächige Aufforstungen (> 1 ha) von z.B. Fichtenreinbeständen,<br />
da sie aus bekannten Gründen anfällig für Kalamitäten und daher mit<br />
vielen ökonomischen und ökologischen Risiken behaftet sind. In jungen Jahren bieten<br />
sie zudem dem Schalenwild Schutz und Äsung, was besonders beim Rehwild zu<br />
höheren Dichten und erschwerter Bejagung führt. In jedem Fall sind bei hohen Schalenwilddichten<br />
Aufforstungen größerer Flächen mit verbissempfindlichen Baumarten<br />
ohne Schutzmaßnahmen nahezu unmöglich. Unter „angepassten“ Schalenwilddich-<br />
130