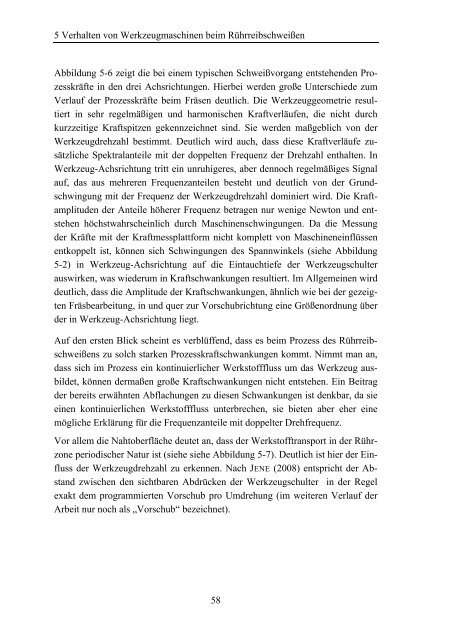Mehr Info - iwb
Mehr Info - iwb
Mehr Info - iwb
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
5 Verhalten von Werkzeugmaschinen beim Rührreibschweißen<br />
Abbildung 5-6 zeigt die bei einem typischen Schweißvorgang entstehenden Prozesskräfte<br />
in den drei Achsrichtungen. Hierbei werden große Unterschiede zum<br />
Verlauf der Prozesskräfte beim Fräsen deutlich. Die Werkzeuggeometrie resultiert<br />
in sehr regelmäßigen und harmonischen Kraftverläufen, die nicht durch<br />
kurzzeitige Kraftspitzen gekennzeichnet sind. Sie werden maßgeblich von der<br />
Werkzeugdrehzahl bestimmt. Deutlich wird auch, dass diese Kraftverläufe zusätzliche<br />
Spektralanteile mit der doppelten Frequenz der Drehzahl enthalten. In<br />
Werkzeug-Achsrichtung tritt ein unruhigeres, aber dennoch regelmäßiges Signal<br />
auf, das aus mehreren Frequenzanteilen besteht und deutlich von der Grundschwingung<br />
mit der Frequenz der Werkzeugdrehzahl dominiert wird. Die Kraftamplituden<br />
der Anteile höherer Frequenz betragen nur wenige Newton und entstehen<br />
höchstwahrscheinlich durch Maschinenschwingungen. Da die Messung<br />
der Kräfte mit der Kraftmessplattform nicht komplett von Maschineneinflüssen<br />
entkoppelt ist, können sich Schwingungen des Spannwinkels (siehe Abbildung<br />
5-2) in Werkzeug-Achsrichtung auf die Eintauchtiefe der Werkzeugschulter<br />
auswirken, was wiederum in Kraftschwankungen resultiert. Im Allgemeinen wird<br />
deutlich, dass die Amplitude der Kraftschwankungen, ähnlich wie bei der gezeigten<br />
Fräsbearbeitung, in und quer zur Vorschubrichtung eine Größenordnung über<br />
der in Werkzeug-Achsrichtung liegt.<br />
Auf den ersten Blick scheint es verblüffend, dass es beim Prozess des Rührreibschweißens<br />
zu solch starken Prozesskraftschwankungen kommt. Nimmt man an,<br />
dass sich im Prozess ein kontinuierlicher Werkstofffluss um das Werkzeug ausbildet,<br />
können dermaßen große Kraftschwankungen nicht entstehen. Ein Beitrag<br />
der bereits erwähnten Abflachungen zu diesen Schwankungen ist denkbar, da sie<br />
einen kontinuierlichen Werkstofffluss unterbrechen, sie bieten aber eher eine<br />
mögliche Erklärung für die Frequenzanteile mit doppelter Drehfrequenz.<br />
Vor allem die Nahtoberfläche deutet an, dass der Werkstofftransport in der Rührzone<br />
periodischer Natur ist (siehe siehe Abbildung 5-7). Deutlich ist hier der Einfluss<br />
der Werkzeugdrehzahl zu erkennen. Nach JENE (2008) entspricht der Abstand<br />
zwischen den sichtbaren Abdrücken der Werkzeugschulter in der Regel<br />
exakt dem programmierten Vorschub pro Umdrehung (im weiteren Verlauf der<br />
Arbeit nur noch als „Vorschub“ bezeichnet).<br />
58