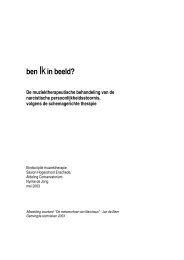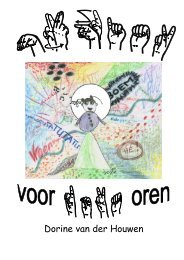1996_Moreau.pdf
1996_Moreau.pdf
1996_Moreau.pdf
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Insgesamt können bessere Übereinstimmungswerte möglicherweise dadurch erhalten<br />
werden, daß die Items statt nach übergeordneten Faktoren nach den eben diskutierten<br />
Merkmalsklassen "beobachtbares Verhalten", "strukturelle musikalische Aspekte" und<br />
"subjektiver Eindruck" angeordnet werden. Dabei können die Rater jedesmal eine<br />
gesonderte Instruktion erhalten, worauf sie mit welchem Blickwinkel zu achten haben.<br />
6.2.3. fehlende Aspekte<br />
Ein Vergleich zu den bestehenden Musiktherapie-Skalen wirft auch die Frage auf,<br />
welche Aspekte in der vorliegenden Skala fehlen. Es wurde bereits erwähnt, daß die<br />
Skala MAKS im Vergleich zu anderen Skalen die differenzierteste Faktorenstruktur und<br />
die vielfältigsten Merkmalskategorien (Verhaltens- merkmale, formale und strukturelle<br />
Musikmerkmale sowie Eindrucksqualitäten) beinhaltet. Dennoch dürfen die<br />
Einsatzmöglichkeiten der Skala MAKS nicht überschätzt werden.<br />
Ein Mangel ist, daß die Skala in der Kodierung der Duoszenen jeweils nur einen Spieler<br />
berücksichtigt. Denkbar ist zwar eine parallele Auswertung beider Spieler, doch wird mit<br />
der Skala nicht die gemeinsame Musik als Ganzes oder "gemeinsames Werk"<br />
(WEYMANN 1990, S.60) erfaßt, wie dies z.B. beim MUSIKOS geschieht (mündliche<br />
Mitteilung, VANGER 1994). Die Skala fußt damit auf dem traditionellen medizinischen<br />
Verständnis von Diagnostik als einem vom Untersucher relativ unabhängigen<br />
Beurteilungsprozeß. Entsprechend ist der Interpretationsspielraum der mittels der Skala<br />
gewonnenen Ergebnisse auf die typischen Verhaltensausprägungen des Klienten<br />
ausgerichtet und daher einseitig. So läßt sich mit der Skala auch weniger der<br />
Therapieprozeß als solches beschreiben. Vielmehr läßt sich mit der Skala das Ergebnis<br />
der Therapie im Hinblick auf den Klienten und die Veränderungen seines (Spiel-<br />
)Verhaltens charakterisieren. Die Skala ist damit nicht für die Prozeßforschung an sich<br />
geeignet, sondern ein diagnostisches Mittel, das der out-come-Forschung zukommen<br />
kann.<br />
137