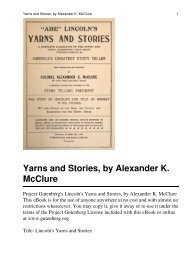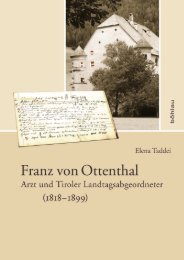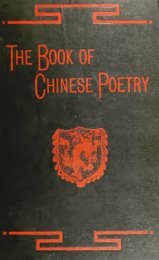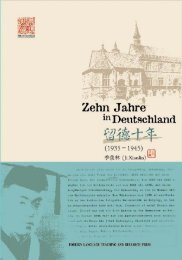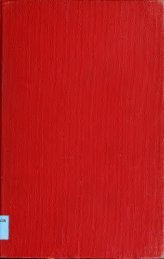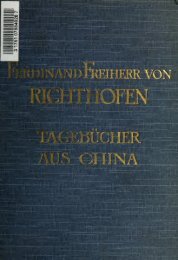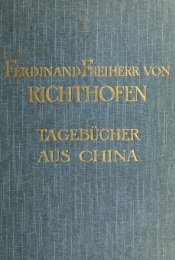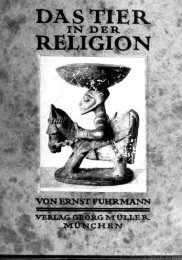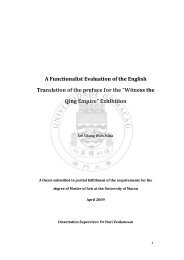Neue Wege beruflicher Qualifizierung zur Stärkung der ...
Neue Wege beruflicher Qualifizierung zur Stärkung der ...
Neue Wege beruflicher Qualifizierung zur Stärkung der ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
– Das Ausbildungsberufsbild als Ganzes gilt verbindlich für beide Partner:<br />
Betrieb und Schule.<br />
– Ausbildungsrahmenpläne für die Aufgaben des Betriebs und Rahmenlehrpläne<br />
für die Berufsschule haben jeweils auf beide Lernorte bezogene Verantwortungsbereiche<br />
zu präzisieren. Damit liegt die Gesamtverantwortung<br />
nicht mehr allein beim Betrieb, son<strong>der</strong>n gemäß EU-Vorschlag von 1979 auf<br />
beiden Seiten.<br />
– Die Aufgaben des Betriebs beziehen sich vornehmlich auf die Mitwirkung<br />
<strong>der</strong> Auszubildenden in <strong>der</strong> betrieblichen Praxis im Sinne von learning by<br />
doing. Dazu gehört auch, dass <strong>der</strong> Ausbil<strong>der</strong> die an den Arbeitsprozess gebundenen<br />
Fachkenntnisse vertieft und sich dabei soweit wie möglich auf die<br />
systematisch erarbeiteten Lerninhalte <strong>der</strong> Berufsschule bezieht.<br />
– Der Lehrplan für die Berufsschule hat in seinen strukturierten Lernfel<strong>der</strong>n<br />
auf die Fortschritte in <strong>der</strong> betrieblichen Ausbildung einzugehen und den<br />
Unterricht in sachlichem und zeitlichem Verbund mit dem Betrieb zu realisieren.<br />
– Mit dem Grundsatz Lernortverbund erwächst die Notwendigkeit, bei <strong>der</strong><br />
Abstimmung von Betrieb und Schule bei<strong>der</strong>seits klar definierte Teilbereiche<br />
auszuweisen. Dies setzt voraus, dass bei Planung und Erstellung von Ausbildungsordnungen<br />
erfahrene betriebliche Ausbil<strong>der</strong> und Lehrer an beruflichen<br />
Schulen von Anfang an in gemeinsamer Verantwortung mitwirken.<br />
5.3 Reduzierung <strong>der</strong> durch das Übergangssystem entstehenden hohen Kosten<br />
Die Auffassung, dass die betriebsgebundene Ausbildung gegenüber den berufsqualifizierenden<br />
Vollzeitschulen dem Staat geringere Kosten verursacht, wird<br />
allgemein vertreten.<br />
Noch bis in die Zeit vor 1980 ergab sich mit dem Übergang von <strong>der</strong> Schulentlassung<br />
in die Lehre für nahezu alle Jugendlichen nicht nur <strong>der</strong> unmittelbare Eintritt<br />
in die Berufsausbildung, son<strong>der</strong>n durch die Ausbildungsvergütung auch eine<br />
teilweise Sicherung des Lebensunterhalts. Dieses Zusammenspiel trug in<br />
Deutschland <strong>zur</strong> positiven Einstellung zum dualen Berufsbildungssystem wie<br />
auch <strong>zur</strong> Geringschätzung vollschulischer Ausbildung bei.<br />
Mit dem Rückgang <strong>der</strong> Eintritte in das Dualsystem unmittelbar nach <strong>der</strong> Schulentlassung<br />
auf ein Drittel <strong>der</strong> Zugänge insgesamt, ohne dass alternativ qualifizierende<br />
Bildungsgänge angeboten werden, entstand für den größeren Teil <strong>der</strong><br />
Schulentlassenen eine prekäre Situation hinsichtlich des immer weiter hinausgeschobenen<br />
Ausbildungsbeginns.<br />
Die oben angesprochenen für die öffentliche Hand niedrigen Kosten des Dualsystems<br />
beziehen sich nur auf den Anteil <strong>der</strong> Jugendlichen, die direkt in die<br />
Ausbildung eintreten, nicht aber auf diejenigen, die jahrelang ins Übergangssystem<br />
bzw. in Warteschleifen eingebunden sind.<br />
169<br />
Betriebliche<br />
Ausbildung<br />
kostengünstig<br />
Übergangssystem<br />
verursacht<br />
hohe Kosten