Immunhistologische Charakterisierung primärer Neoplasien des ...
Immunhistologische Charakterisierung primärer Neoplasien des ...
Immunhistologische Charakterisierung primärer Neoplasien des ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Diskussion<br />
Oligoastrozytoms ähnliche genetische Veränderungen, so dass man neuerdings von<br />
einer Histogenese aus einer gemeinsamen Stammzelle ausgeht und nicht mehr von<br />
einem zusammengesetzten Tumor (Kollisionstumor) spricht (KRAUS et al., 1995)<br />
5.4.4 Ependymale Tumoren<br />
Zwischen den kaninen und felinen Tumoren gab es hinsichtlich der Lokalisation keine<br />
Unterschiede. 6 der Tumoren waren typischerweise in den Seitenventrikeln oder<br />
im 4. Ventrikel zu finden (LUGINBÜHL et al., 1968; CHAFFEE, 1977; ZACHARY et<br />
al., 1981; BAUMGÄRTNER und PEIXOTO, 1987). Parenchymatöses Wachstum<br />
wurde, wie bei 3 Tieren (Nr. 46, 49 und 50) beobachtet, in der Literatur nicht beschrieben.<br />
Eine Erklärung dieses Befun<strong>des</strong> ist die Tatsache, dass pro Tumor meistens<br />
nur ein Paraffinblock und somit nur eine Ebene der Neoplasie zur Verfügung<br />
stand. In einer anderen Ebene hätte möglicherweise eine intraventrikuläre Lokalisation<br />
diagnostiziert werden können. Die als Ependymome eingeteilten Tumoren<br />
stimmten in ihren histologischen Kriterien mit den in der Literatur beschriebenen ü-<br />
berein (SCHIEFER und DAHME, 1962; BAUMGÄRTNER und PEIXOTO, 1987;<br />
KOESTNER et al. 1999; KOESTNER und HIGGINS, 2002). Die bessere Darstellung<br />
der Pseudo- und echten Rosetten bei den Katzen war auch bei den hier beschriebenen<br />
Fällen eindeutig zu erkennen. Ein kanines Ependymom (Nr. 46) wies keine der<br />
beiden Rosettenarten auf. Pseudorosetten waren hier nur angedeutet. In einem Fall<br />
(Nr. 48) wurde in den gut differenzierten Umfangsvermehrungen Areale mit erhöhten<br />
Mitoseraten (bis zu 4/hpf) beobachtet. Bei dem Hund mit der Nr. 49 wurde die Neoplasie<br />
aufgrund der papillären Anordnung der Zellen, in Anlehnung an die von<br />
KOESTNER und HIGGINS (2002) beschriebene Variante, als papilläres Ependymom<br />
klassifiziert. Aufgrund der oligodendrozytenähnlichen Struktur und <strong>des</strong> zusätzlichen<br />
Vorkommens von Rosetten ist ein Fall (Nr. 50), in Anlehnung an die humanmedizinische<br />
Klassifikation (MIN und SCHEITHAUER, 1997; KLEIHUES und CAVENEE<br />
2000), als klarzellige Variante <strong>des</strong> Ependymoms eingeteilt worden. Veterinärmedizinisch<br />
wurde dieser Subtyp bis jetzt noch nicht beschrieben. Die anaplastischen E-<br />
pendymome wiesen, mit Ausnahme <strong>des</strong> Tieres Nr. 51, im Gegensatz zu der in der<br />
Literatur beschriebenen erhöhten Mitoserate nur 1 bis 2 Mitosen/hpf auf (FOX et al.,<br />
1973; KOESTNER et al., 1999; MICHIMAE et al., 2004). Aufgrund der erhöhten Zelldichte<br />
(Nr. 53), der starken Pleomorphie der Zellen (Nr. 52) und der mono- und bi-<br />
174


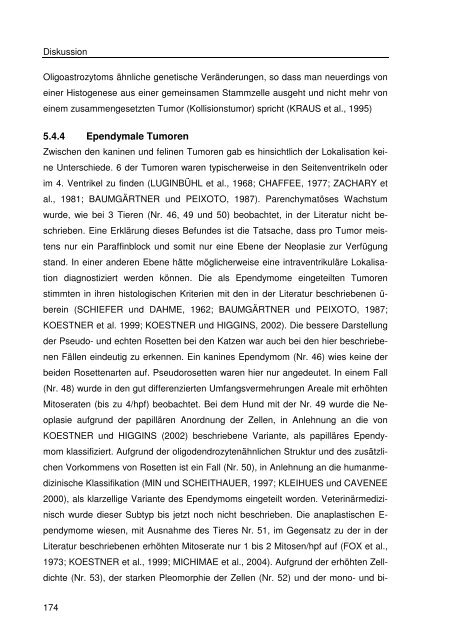



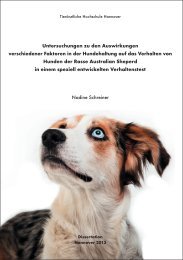



![Tmnsudation.] - TiHo Bibliothek elib](https://img.yumpu.com/23369022/1/174x260/tmnsudation-tiho-bibliothek-elib.jpg?quality=85)






