Immunhistologische Charakterisierung primärer Neoplasien des ...
Immunhistologische Charakterisierung primärer Neoplasien des ...
Immunhistologische Charakterisierung primärer Neoplasien des ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Diskussion<br />
5.5 <strong>Immunhistologische</strong> Untersuchung<br />
Die Immunhistologie gehört in der Diagnostik von Hirntumoren heutzutage zu den<br />
routinemäßig angewandten Methoden. Mit Hilfe von mono- und polyklonalen Antikörpern<br />
können zelluläre Moleküle unter Verwendung immunhistologischer Techniken<br />
auf lichtmikroskopischer Ebene sichtbar gemacht werden. In der Diagnose und<br />
Differentialdiagnose von Tumoren können diese <strong>des</strong>halb angewendet werden, weil<br />
die von den Zellen gebildeten Antigene auch nach der neoplastischen Transformation<br />
mehr oder weniger zuverlässig nachweisbar sind. Es wird dabei vorausgesetzt,<br />
dass sich ein Tumor von bekannten und immunhistologisch charakterisierten Zellen<br />
ableiten lässt (SCHWECHHEIMER, 1990). Dieses ist jedoch nicht immer der Fall,<br />
gerade bei malignen <strong>Neoplasien</strong> können atypische Zellen auftreten, zu denen es<br />
kein nicht-neoplastisches Pendant gibt (RUBINSTEIN, 1964). Durch die fortschreitende<br />
Anaplasie kann es zu Verlust von Antigenexpression und somit zu (falsch-)<br />
negativen immunhistologischen Ergebnissen kommen (SCHWECHHEIMER, 1990).<br />
Wie aus den in dieser Studie gewonnenen Ergebnissen und den Angaben aus der<br />
Literatur zu entnehmen ist, gibt es keine für Hirntumoren spezifischen Antigene<br />
(SCHWECHHEIMER, 1990). Der negative oder positive Ausfall einer Immunreaktion<br />
kann eine am H.E.-Schnitt gestellte Diagnose nur mehr oder weniger wahrscheinlich<br />
machen. Die Markierungen zeigen allenfalls eine Differenzierung und nicht unbedingt<br />
die Histogenese eines Tumors an.<br />
Der Einsatz der immunhistologischen Untersuchung ist dann indikativ, wenn die Diagnose<br />
am H.E.-Schnitt nicht gestellt werden kann oder abgesichert werden soll.<br />
<strong>Immunhistologische</strong> Befunde sind nur im Zusammenhang mit den klinischen Angaben<br />
und der histologischen Verdachtsdiagnose interpretierbar.<br />
In der Mehrzahl der in dieser Studie untersuchten Tumoren konnte die Diagnose bereits<br />
am H.E.-Schnitt gestellt werden. Bei den Tumoren mit 2 Verdachtsdiagnosen,<br />
brachte das immunhistologische Expressionsmuster häufig die entscheidenden Hinweise.<br />
Bei der Neoplasie, die nicht am H.E.-Schnitt klassifiziert werden konnte, konnte<br />
die immunhistologische Untersuchung nicht zur Diagnosefindung beitragen.<br />
Die Grundlage für die Diagnosestellung bildet der histologische Befund am H.E.-<br />
Schnitt, zusammen mit der Erfahrung und dem Kenntnisstand <strong>des</strong> Untersuchers. Klinische<br />
Daten wie Alter, Rasse, Geschlecht, Lokalisation und makroskopische Kriterien<br />
<strong>des</strong> Tumors sollten immer mit einbezogen werden.<br />
186


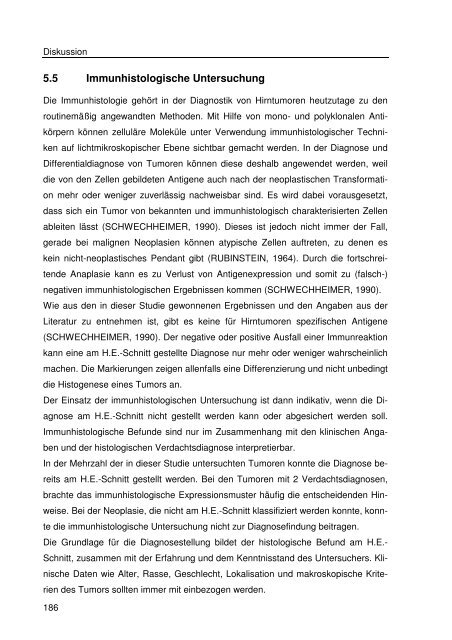



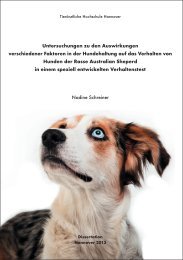



![Tmnsudation.] - TiHo Bibliothek elib](https://img.yumpu.com/23369022/1/174x260/tmnsudation-tiho-bibliothek-elib.jpg?quality=85)






