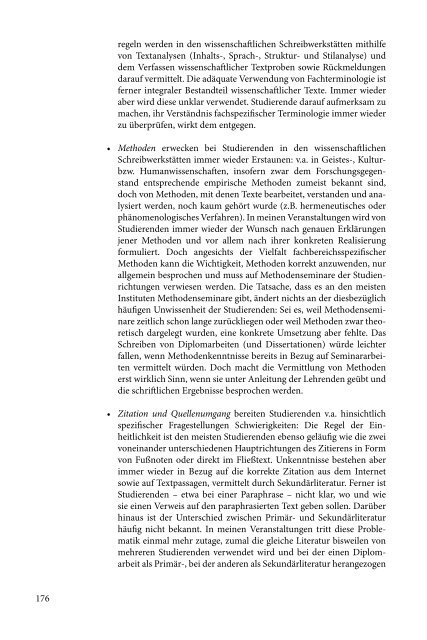linguistische
linguistische
linguistische
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
176<br />
regeln werden in den wissenschaftlichen Schreibwerkstätten mithilfe<br />
von Textanalysen (Inhalts-, Sprach-, Struktur- und Stilanalyse) und<br />
dem Verfassen wissenschaftlicher Textproben sowie Rückmeldungen<br />
darauf vermittelt. Die adäquate Verwendung von Fachterminologie ist<br />
ferner integraler Bestandteil wissenschaftlicher Texte. Immer wieder<br />
aber wird diese unklar verwendet. Studierende darauf aufmerksam zu<br />
machen, ihr Verständnis fachspezifischer Terminologie immer wieder<br />
zu überprüfen, wirkt dem entgegen.<br />
• Methoden erwecken bei Studierenden in den wissenschaftlichen<br />
Schreibwerkstätten immer wieder Erstaunen: v.a. in Geistes-, Kultur-<br />
bzw. Humanwissenschaften, insofern zwar dem Forschungsgegenstand<br />
entsprechende empirische Methoden zumeist bekannt sind,<br />
doch von Methoden, mit denen Texte bearbeitet, verstanden und analysiert<br />
werden, noch kaum gehört wurde (z.B. hermeneutisches oder<br />
phänomenologisches Verfahren). In meinen Veranstaltungen wird von<br />
Studierenden immer wieder der Wunsch nach genauen Erklärungen<br />
jener Methoden und vor allem nach ihrer konkreten Realisierung<br />
formuliert. Doch angesichts der Vielfalt fachbereichsspezifischer<br />
Methoden kann die Wichtigkeit, Methoden korrekt anzuwenden, nur<br />
allgemein besprochen und muss auf Methodenseminare der Studienrichtungen<br />
verwiesen werden. Die Tatsache, dass es an den meisten<br />
Instituten Methodenseminare gibt, ändert nichts an der diesbezüglich<br />
häufigen Unwissenheit der Studierenden: Sei es, weil Methodenseminare<br />
zeitlich schon lange zurückliegen oder weil Methoden zwar theoretisch<br />
dargelegt wurden, eine konkrete Umsetzung aber fehlte. Das<br />
Schreiben von Diplomarbeiten (und Dissertationen) würde leichter<br />
fallen, wenn Methodenkenntnisse bereits in Bezug auf Seminararbeiten<br />
vermittelt würden. Doch macht die Vermittlung von Methoden<br />
erst wirklich Sinn, wenn sie unter Anleitung der Lehrenden geübt und<br />
die schriftlichen Ergebnisse besprochen werden.<br />
• Zitation und Quellenumgang bereiten Studierenden v.a. hinsichtlich<br />
spezifischer Fragestellungen Schwierigkeiten: Die Regel der Einheitlichkeit<br />
ist den meisten Studierenden ebenso geläufig wie die zwei<br />
voneinander unterschiedenen Hauptrichtungen des Zitierens in Form<br />
von Fußnoten oder direkt im Fließtext. Unkenntnisse bestehen aber<br />
immer wieder in Bezug auf die korrekte Zitation aus dem Internet<br />
sowie auf Textpassagen, vermittelt durch Sekundärliteratur. Ferner ist<br />
Studierenden – etwa bei einer Paraphrase – nicht klar, wo und wie<br />
sie einen Verweis auf den paraphrasierten Text geben sollen. Darüber<br />
hinaus ist der Unterschied zwischen Primär- und Sekundärliteratur<br />
häufig nicht bekannt. In meinen Veranstaltungen tritt diese Problematik<br />
einmal mehr zutage, zumal die gleiche Literatur bisweilen von<br />
mehreren Studierenden verwendet wird und bei der einen Diplomarbeit<br />
als Primär-, bei der anderen als Sekundärliteratur herangezogen<br />
kissling_korr.1.indd 176 14.09.2006 11:09:59 Uhr