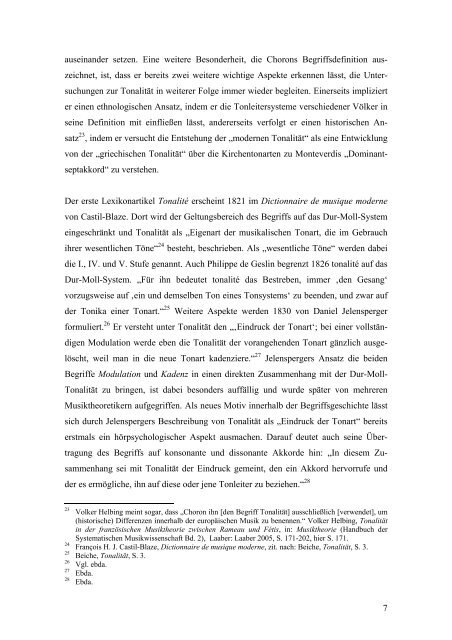Klangzentren und Tonalität - Musiktheorie / Musikanalyse ...
Klangzentren und Tonalität - Musiktheorie / Musikanalyse ...
Klangzentren und Tonalität - Musiktheorie / Musikanalyse ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
auseinander setzen. Eine weitere Besonderheit, die Chorons Begriffsdefinition auszeichnet,<br />
ist, dass er bereits zwei weitere wichtige Aspekte erkennen lässt, die Untersuchungen<br />
zur <strong>Tonalität</strong> in weiterer Folge immer wieder begleiten. Einerseits impliziert<br />
er einen ethnologischen Ansatz, indem er die Tonleitersysteme verschiedener Völker in<br />
seine Definition mit einfließen lässt, andererseits verfolgt er einen historischen Ansatz<br />
23 , indem er versucht die Entstehung der „modernen <strong>Tonalität</strong>“ als eine Entwicklung<br />
von der „griechischen <strong>Tonalität</strong>“ über die Kirchentonarten zu Monteverdis „Dominantseptakkord“<br />
zu verstehen.<br />
Der erste Lexikonartikel Tonalité erscheint 1821 im Dictionnaire de musique moderne<br />
von Castil-Blaze. Dort wird der Geltungsbereich des Begriffs auf das Dur-Moll-System<br />
eingeschränkt <strong>und</strong> <strong>Tonalität</strong> als „Eigenart der musikalischen Tonart, die im Gebrauch<br />
ihrer wesentlichen Töne“ 24 besteht, beschrieben. Als „wesentliche Töne“ werden dabei<br />
die I., IV. <strong>und</strong> V. Stufe genannt. Auch Philippe de Geslin begrenzt 1826 tonalité auf das<br />
Dur-Moll-System. „Für ihn bedeutet tonalité das Bestreben, immer ‚den Gesang‘<br />
vorzugsweise auf ‚ein <strong>und</strong> demselben Ton eines Tonsystems‘ zu beenden, <strong>und</strong> zwar auf<br />
der Tonika einer Tonart.“ 25 Weitere Aspekte werden 1830 von Daniel Jelensperger<br />
formuliert. 26 Er versteht unter <strong>Tonalität</strong> den „‚Eindruck der Tonart‘; bei einer vollständigen<br />
Modulation werde eben die <strong>Tonalität</strong> der vorangehenden Tonart gänzlich ausgelöscht,<br />
weil man in die neue Tonart kadenziere.“ 27 Jelenspergers Ansatz die beiden<br />
Begriffe Modulation <strong>und</strong> Kadenz in einen direkten Zusammenhang mit der Dur-Moll-<br />
<strong>Tonalität</strong> zu bringen, ist dabei besonders auffällig <strong>und</strong> wurde später von mehreren<br />
Musiktheoretikern aufgegriffen. Als neues Motiv innerhalb der Begriffsgeschichte lässt<br />
sich durch Jelenspergers Beschreibung von <strong>Tonalität</strong> als „Eindruck der Tonart“ bereits<br />
erstmals ein hörpsychologischer Aspekt ausmachen. Darauf deutet auch seine Übertragung<br />
des Begriffs auf konsonante <strong>und</strong> dissonante Akkorde hin: „In diesem Zusammenhang<br />
sei mit <strong>Tonalität</strong> der Eindruck gemeint, den ein Akkord hervorrufe <strong>und</strong><br />
der es ermögliche, ihn auf diese oder jene Tonleiter zu beziehen.“ 28<br />
23 Volker Helbing meint sogar, dass „Choron ihn [den Begriff <strong>Tonalität</strong>] ausschließlich [verwendet], um<br />
(historische) Differenzen innerhalb der europäischen Musik zu benennen.“ Volker Helbing, <strong>Tonalität</strong><br />
in der französischen <strong>Musiktheorie</strong> zwischen Rameau <strong>und</strong> Fétis, in: <strong>Musiktheorie</strong> (Handbuch der<br />
Systematischen Musikwissenschaft Bd. 2), Laaber: Laaber 2005, S. 171-202, hier S. 171.<br />
24 François H. J. Castil-Blaze, Dictionnaire de musique moderne, zit. nach: Beiche, <strong>Tonalität</strong>, S. 3.<br />
25 Beiche, <strong>Tonalität</strong>, S. 3.<br />
26 Vgl. ebda.<br />
27 Ebda.<br />
28 Ebda.<br />
7