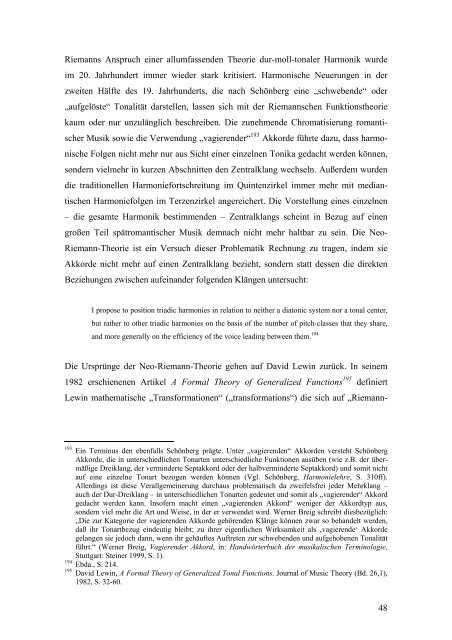Klangzentren und Tonalität - Musiktheorie / Musikanalyse ...
Klangzentren und Tonalität - Musiktheorie / Musikanalyse ...
Klangzentren und Tonalität - Musiktheorie / Musikanalyse ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Riemanns Anspruch einer allumfassenden Theorie dur-moll-tonaler Harmonik wurde<br />
im 20. Jahrh<strong>und</strong>ert immer wieder stark kritisiert. Harmonische Neuerungen in der<br />
zweiten Hälfte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts, die nach Schönberg eine „schwebende“ oder<br />
„aufgelöste“ <strong>Tonalität</strong> darstellen, lassen sich mit der Riemannschen Funktionstheorie<br />
kaum oder nur unzulänglich beschreiben. Die zunehmende Chromatisierung romantischer<br />
Musik sowie die Verwendung „vagierender“ 193 Akkorde führte dazu, dass harmonische<br />
Folgen nicht mehr nur aus Sicht einer einzelnen Tonika gedacht werden können,<br />
sondern vielmehr in kurzen Abschnitten den Zentralklang wechseln. Außerdem wurden<br />
die traditionellen Harmoniefortschreitung im Quintenzirkel immer mehr mit mediantischen<br />
Harmoniefolgen im Terzenzirkel angereichert. Die Vorstellung eines einzelnen<br />
– die gesamte Harmonik bestimmenden – Zentralklangs scheint in Bezug auf einen<br />
großen Teil spätromantischer Musik demnach nicht mehr haltbar zu sein. Die Neo-<br />
Riemann-Theorie ist ein Versuch dieser Problematik Rechnung zu tragen, indem sie<br />
Akkorde nicht mehr auf einen Zentralklang bezieht, sondern statt dessen die direkten<br />
Beziehungen zwischen aufeinander folgenden Klängen untersucht:<br />
I propose to position triadic harmonies in relation to neither a diatonic system nor a tonal center,<br />
but rather to other triadic harmonies on the basis of the number of pitch-classes that they share,<br />
and more generally on the efficiency of the voice leading between them. 194<br />
Die Ursprünge der Neo-Riemann-Theorie gehen auf David Lewin zurück. In seinem<br />
1982 erschienenen Artikel A Formal Theory of Generalized Functions 195 definiert<br />
Lewin mathematische „Transformationen“ („transformations“) die sich auf „Riemann-<br />
193<br />
Ein Terminus den ebenfalls Schönberg prägte. Unter „vagierenden“ Akkorden versteht Schönberg<br />
Akkorde, die in unterschiedlichen Tonarten unterschiedliche Funktionen ausüben (wie z.B. der übermäßige<br />
Dreiklang, der verminderte Septakkord oder der halbverminderte Septakkord) <strong>und</strong> somit nicht<br />
auf eine einzelne Tonart bezogen werden können (Vgl. Schönberg, Harmonielehre, S. 310ff).<br />
Allerdings ist diese Verallgemeinerung durchaus problematisch da zweifelsfrei jeder Mehrklang –<br />
auch der Dur-Dreiklang – in unterschiedlichen Tonarten gedeutet <strong>und</strong> somit als „vagierender“ Akkord<br />
gedacht werden kann. Insofern macht einen „vagierenden Akkord“ weniger der Akkordtyp aus,<br />
sondern viel mehr die Art <strong>und</strong> Weise, in der er verwendet wird. Werner Breig schreibt diesbezüglich:<br />
„Die zur Kategorie der vagierenden Akkorde gehörenden Klänge können zwar so behandelt werden,<br />
daß ihr Tonartbezug eindeutig bleibt; zu ihrer eigentlichen Wirksamkeit als ‚vagierende‘ Akkorde<br />
gelangen sie jedoch dann, wenn ihr gehäuftes Auftreten zur schwebenden <strong>und</strong> aufgehobenen <strong>Tonalität</strong><br />
führt.“ (Werner Breig, Vagierender Akkord, in: Handwörterbuch der musikalischen Terminologie,<br />
Stuttgart: Steiner 1999, S. 1).<br />
194<br />
Ebda., S. 214.<br />
195<br />
David Lewin, A Formal Theory of Generalized Tonal Functions. Journal of Music Theory (Bd. 26,1),<br />
1982, S. 32-60.<br />
48