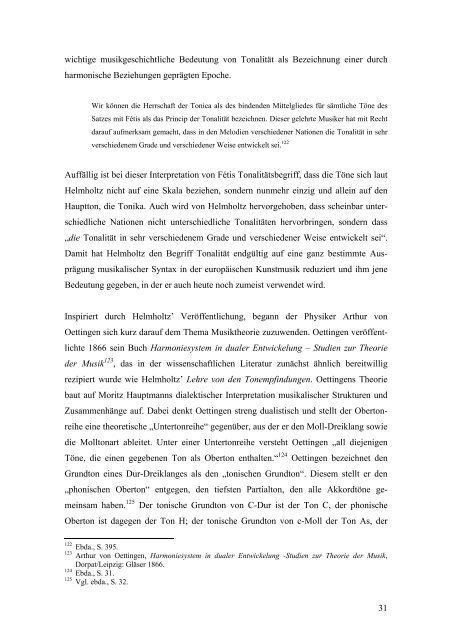Klangzentren und Tonalität - Musiktheorie / Musikanalyse ...
Klangzentren und Tonalität - Musiktheorie / Musikanalyse ...
Klangzentren und Tonalität - Musiktheorie / Musikanalyse ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
wichtige musikgeschichtliche Bedeutung von <strong>Tonalität</strong> als Bezeichnung einer durch<br />
harmonische Beziehungen geprägten Epoche.<br />
Wir können die Herrschaft der Tonica als des bindenden Mittelgliedes für sämtliche Töne des<br />
Satzes mit Fétis als das Princip der <strong>Tonalität</strong> bezeichnen. Dieser gelehrte Musiker hat mit Recht<br />
darauf aufmerksam gemacht, dass in den Melodien verschiedener Nationen die <strong>Tonalität</strong> in sehr<br />
verschiedenem Grade <strong>und</strong> verschiedener Weise entwickelt sei. 122<br />
Auffällig ist bei dieser Interpretation von Fétis <strong>Tonalität</strong>sbegriff, dass die Töne sich laut<br />
Helmholtz nicht auf eine Skala beziehen, sondern nunmehr einzig <strong>und</strong> allein auf den<br />
Hauptton, die Tonika. Auch wird von Helmholtz hervorgehoben, dass scheinbar unterschiedliche<br />
Nationen nicht unterschiedliche <strong>Tonalität</strong>en hervorbringen, sondern dass<br />
„die <strong>Tonalität</strong> in sehr verschiedenem Grade <strong>und</strong> verschiedener Weise entwickelt sei“.<br />
Damit hat Helmholtz den Begriff <strong>Tonalität</strong> endgültig auf eine ganz bestimmte Ausprägung<br />
musikalischer Syntax in der europäischen Kunstmusik reduziert <strong>und</strong> ihm jene<br />
Bedeutung gegeben, in der er auch heute noch zumeist verwendet wird.<br />
Inspiriert durch Helmholtz’ Veröffentlichung, begann der Physiker Arthur von<br />
Oettingen sich kurz darauf dem Thema <strong>Musiktheorie</strong> zuzuwenden. Oettingen veröffentlichte<br />
1866 sein Buch Harmoniesystem in dualer Entwickelung – Studien zur Theorie<br />
der Musik 123 , das in der wissenschaftlichen Literatur zunächst ähnlich bereitwillig<br />
rezipiert wurde wie Helmholtz’ Lehre von den Tonempfindungen. Oettingens Theorie<br />
baut auf Moritz Hauptmanns dialektischer Interpretation musikalischer Strukturen <strong>und</strong><br />
Zusammenhänge auf. Dabei denkt Oettingen streng dualistisch <strong>und</strong> stellt der Obertonreihe<br />
eine theoretische „Untertonreihe“ gegenüber, aus der er den Moll-Dreiklang sowie<br />
die Molltonart ableitet. Unter einer Untertonreihe versteht Oettingen „all diejenigen<br />
Töne, die einen gegebenen Ton als Oberton enthalten.“ 124 Oettingen bezeichnet den<br />
Gr<strong>und</strong>ton eines Dur-Dreiklanges als den „tonischen Gr<strong>und</strong>ton“. Diesem stellt er den<br />
„phonischen Oberton“ entgegen, den tiefsten Partialton, den alle Akkordtöne gemeinsam<br />
haben. 125 Der tonische Gr<strong>und</strong>ton von C-Dur ist der Ton C, der phonische<br />
Oberton ist dagegen der Ton H; der tonische Gr<strong>und</strong>ton von c-Moll der Ton As, der<br />
122<br />
Ebda., S. 395.<br />
123<br />
Arthur von Oettingen, Harmoniesystem in dualer Entwickelung -Studien zur Theorie der Musik,<br />
Dorpat/Leipzig: Gläser 1866.<br />
124<br />
Ebda., S. 31.<br />
125<br />
Vgl. ebda., S. 32.<br />
31