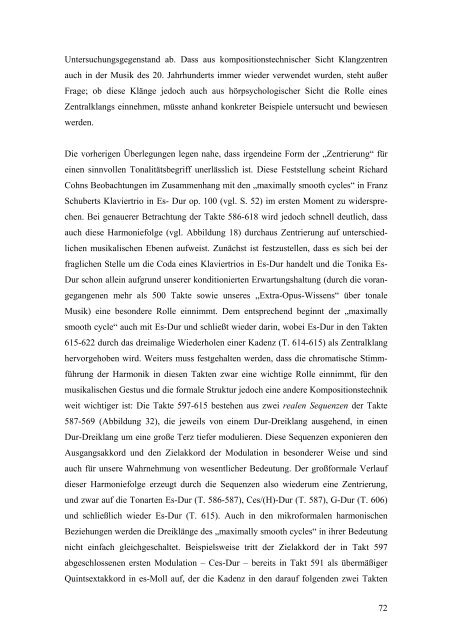Klangzentren und Tonalität - Musiktheorie / Musikanalyse ...
Klangzentren und Tonalität - Musiktheorie / Musikanalyse ...
Klangzentren und Tonalität - Musiktheorie / Musikanalyse ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Untersuchungsgegenstand ab. Dass aus kompositionstechnischer Sicht <strong>Klangzentren</strong><br />
auch in der Musik des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts immer wieder verwendet wurden, steht außer<br />
Frage; ob diese Klänge jedoch auch aus hörpsychologischer Sicht die Rolle eines<br />
Zentralklangs einnehmen, müsste anhand konkreter Beispiele untersucht <strong>und</strong> bewiesen<br />
werden.<br />
Die vorherigen Überlegungen legen nahe, dass irgendeine Form der „Zentrierung“ für<br />
einen sinnvollen <strong>Tonalität</strong>sbegriff unerlässlich ist. Diese Feststellung scheint Richard<br />
Cohns Beobachtungen im Zusammenhang mit den „maximally smooth cycles“ in Franz<br />
Schuberts Klaviertrio in Es- Dur op. 100 (vgl. S. 52) im ersten Moment zu widersprechen.<br />
Bei genauerer Betrachtung der Takte 586-618 wird jedoch schnell deutlich, dass<br />
auch diese Harmoniefolge (vgl. Abbildung 18) durchaus Zentrierung auf unterschiedlichen<br />
musikalischen Ebenen aufweist. Zunächst ist festzustellen, dass es sich bei der<br />
fraglichen Stelle um die Coda eines Klaviertrios in Es-Dur handelt <strong>und</strong> die Tonika Es-<br />
Dur schon allein aufgr<strong>und</strong> unserer konditionierten Erwartungshaltung (durch die vorangegangenen<br />
mehr als 500 Takte sowie unseres „Extra-Opus-Wissens“ über tonale<br />
Musik) eine besondere Rolle einnimmt. Dem entsprechend beginnt der „maximally<br />
smooth cycle“ auch mit Es-Dur <strong>und</strong> schließt wieder darin, wobei Es-Dur in den Takten<br />
615-622 durch das dreimalige Wiederholen einer Kadenz (T. 614-615) als Zentralklang<br />
hervorgehoben wird. Weiters muss festgehalten werden, dass die chromatische Stimmführung<br />
der Harmonik in diesen Takten zwar eine wichtige Rolle einnimmt, für den<br />
musikalischen Gestus <strong>und</strong> die formale Struktur jedoch eine andere Kompositionstechnik<br />
weit wichtiger ist: Die Takte 597-615 bestehen aus zwei realen Sequenzen der Takte<br />
587-569 (Abbildung 32), die jeweils von einem Dur-Dreiklang ausgehend, in einen<br />
Dur-Dreiklang um eine große Terz tiefer modulieren. Diese Sequenzen exponieren den<br />
Ausgangsakkord <strong>und</strong> den Zielakkord der Modulation in besonderer Weise <strong>und</strong> sind<br />
auch für unsere Wahrnehmung von wesentlicher Bedeutung. Der großformale Verlauf<br />
dieser Harmoniefolge erzeugt durch die Sequenzen also wiederum eine Zentrierung,<br />
<strong>und</strong> zwar auf die Tonarten Es-Dur (T. 586-587), Ces/(H)-Dur (T. 587), G-Dur (T. 606)<br />
<strong>und</strong> schließlich wieder Es-Dur (T. 615). Auch in den mikroformalen harmonischen<br />
Beziehungen werden die Dreiklänge des „maximally smooth cycles“ in ihrer Bedeutung<br />
nicht einfach gleichgeschaltet. Beispielsweise tritt der Zielakkord der in Takt 597<br />
abgeschlossenen ersten Modulation – Ces-Dur – bereits in Takt 591 als übermäßiger<br />
Quintsextakkord in es-Moll auf, der die Kadenz in den darauf folgenden zwei Takten<br />
72