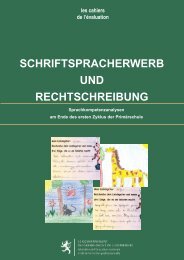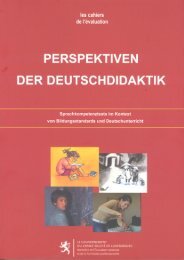Peer-Mediation im Schulalltag : ein Handbuch für Lehrer
Peer-Mediation im Schulalltag : ein Handbuch für Lehrer
Peer-Mediation im Schulalltag : ein Handbuch für Lehrer
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
In der <strong>Peer</strong>-group geht es ferner um die „Soziabilität“, d.h. um die Fähigkeit, mit verschiedenen<br />
Menschen und damit verbundenen Situationen umgehen zu können: Konflikte und Diskussionen<br />
in <strong>ein</strong>em konstruktiven Stil führen, sich trauen z.B. über den eigenen Lieblingsstar in <strong>ein</strong>er Gruppe<br />
zu sprechen; Kontakte herstellen, Beziehungen aufbauen und Freundschaften selbst aktiv mitgestalten.<br />
<strong>Peer</strong>-Beziehungen <strong>ein</strong>zugehen, heißt: mit den eigenen Gefühlen und Ansichten öffentlich<br />
umgehen zu können.<br />
Die <strong>Peer</strong>-group ist vor allem <strong>ein</strong> Korrektiv zur Familie sowie <strong>ein</strong>e Ergänzung zu den häuslichen<br />
Wertvorstellungen und Verhaltensweisen, denn in der <strong>Peer</strong>-group wird oft aufgehoben, was bislang<br />
in Familie und/ oder Schule als normal galt/ gilt. <strong>Peer</strong>-groups prägen jeweils <strong>ein</strong>en best<strong>im</strong>mten<br />
kulturellen Lebensstil mit den dazugehörigen kulturellen Praxen und Ausdrucksformen. Die<br />
meisten <strong>Peer</strong>-groups entstehen in der Schule und über die Schule, demnach könnte die Schule als<br />
„Übergangsobjekt“ bezeichnet werden. Bei der Umsetzung der Entwicklungsaufgaben können Medien<br />
und Medienerfahrungen unterstützend s<strong>ein</strong>. Dies insbesondere <strong>im</strong> Zusammenhang mit der<br />
Abtrennung/ Abgrenzung vom elterlichen Geschmack. Es kommt zu <strong>ein</strong>em Zusammenprall von Familienkultur<br />
und <strong>Peer</strong>-group-Kultur. Die Jugendlichen müssen die Balance zwischen den häuslichfamiliären<br />
und den peer-group-orientierten Erfahrungen schaffen, woraus sie die eigene, d.h. individuelle<br />
Geschmackskultur entwickeln. Diese beiden Kulturen zu verbinden und dabei den<br />
eigenen Stil zu entwickeln, ist <strong>ein</strong>e entscheidende kulturorientierte Integrationsleistung.<br />
In den <strong>Peer</strong>-groups finden Jugendliche zum <strong>ein</strong>en die Chance, Rollenstereotype zu relativieren, Defizite<br />
und Misserfolge aus anderen Lebensfeldern zu kompensieren, ihr Selbstwertgefühl zu verbessern,<br />
sowie Anerkennung und Akzeptanz zu erfahren. Die Bildung von Jugendcliquen kann als<br />
Reaktion auf negative Erlebnisse angesehen werden, sozusagen als <strong>ein</strong>e „Flucht“ in <strong>ein</strong> aufmerksamkeitssicherndes<br />
soziales Gefüge bzw. in <strong>ein</strong> Gruppenprestige. 62<br />
Zum anderen können <strong>Peer</strong>-Groups auch negative Seiten haben, zum Beispiel können sie bereits<br />
bestehende Probleme verstärken und Rollen verfestigen. Daraus entstehen Rivalität, Machtkampf,<br />
dominierendes Auftreten und Ritualisierungen, zu denen Mutproben, Aggression und abschätziges<br />
Verhalten gegenüber anderen (anders aussehenden, gekleideten, sich anders verhaltenden<br />
Gruppen, Fremden und/ oder Schwächeren) und demonstrativer Konsum von Suchtmitteln zu zählen<br />
sind. Diese Gruppen werden <strong>für</strong> andere dann zum Problem, wenn aus ihnen heraus Gewalt entsteht<br />
und Straftaten begangen werden. Viele Jugendliche mit geringem Selbstwertgefühl, mit Frustrationen<br />
und Enttäuschungserlebnissen, versuchen dies durch Aggressivität zu kompensieren.<br />
In der Gruppe können sie sich sicher und geschützt fühlen und sich „in der Gruppe verstecken“,<br />
mit der Folge, dass sie sich – mit gruppengestütztem Machtgefühl ausgestattet – nun mehr trauen,<br />
mehr riskieren und weniger Verantwortlichkeit <strong>für</strong> ihr eigenes Tun spüren. 63 Wie Studien zeigen,<br />
machen insbesondere männliche Jugendliche über den Weg der Gewalt auf sich aufmerksam. Dies<br />
um <strong>ein</strong>en (höheren) Status in der Gleichaltrigengruppe zu erlangen, Macht, Selbstwert oder <strong>ein</strong>en<br />
besonderen Kick zu erleben. K<strong>ein</strong> Wunder, wenn es dann aus derartigen Gruppensituationen heraus<br />
zu (gewalttätigen) Straftaten kommt. Meist heißt es dazu: „All<strong>ein</strong> wär’ ihm das nicht <strong>ein</strong>gefallen!“<br />
Die Sehnsucht nach Abenteuer, Grenzüberschreitung, Nervenkitzel, Risiko und gefährlichem Übermut<br />
ist <strong>im</strong> Jugendalter entwicklungsbedingt hoch und zählt zu den entscheidenden Antriebskräf-<br />
62 vgl. HURRELMANN/ PALENTIEN 1995, 160<br />
63 vgl. LKA-Baust<strong>ein</strong>e, Bayerisches Landeskr<strong>im</strong>inalamt, Sachgebiet 133, in: Politische Studien, Sonderheft 4/1997:<br />
Gewaltprävention bei Kindern und Jugendlichen. Was tun wir <strong>für</strong> den friedlichen Umgang mit<strong>ein</strong>ander?; München 1997, 124f<br />
104