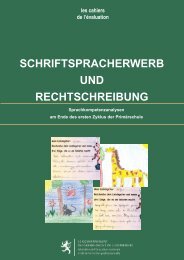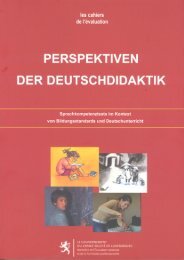Peer-Mediation im Schulalltag : ein Handbuch für Lehrer
Peer-Mediation im Schulalltag : ein Handbuch für Lehrer
Peer-Mediation im Schulalltag : ein Handbuch für Lehrer
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Peer</strong>-<strong>Mediation</strong> <strong>im</strong> <strong>Schulalltag</strong> Modul�Gewalt - Konflikt<br />
Die offene Botschaft, d.h. der Inhalt der Mitteilung, wird in der TA „soziale Ebene“ (A) genannt. Der<br />
Erfolg der Kommunikation hängt allerdings davon ab, ob der Empfänger die „latente Botschaft“,<br />
die Weise, wie der Inhalt gem<strong>ein</strong>t ist, versteht und darauf <strong>ein</strong>gehen kann. Die „psychologische<br />
Ebene“ (B) gibt Auskunft über den inneren Zustand, die Motivation des Senders und die Beziehung<br />
zum Empfänger.<br />
Motive <strong>für</strong> Doppelbotschaften sind u.a.: 84<br />
- Sie enthalten den Reiz des Versteckspiels und Entdecktwerdens<br />
(z.B. Bedürfnis nach An-/Aufregung, Flirt).<br />
- Jemand kann <strong>ein</strong>en Teil der Botschaft verbergen wollen, weil die offizielle Regel von<br />
Anstand nicht erlaubt, diese Botschaft offen oder direkt auszusprechen<br />
(z.B. Scham als Hindernis).<br />
- Es kann s<strong>ein</strong>, dass es zu ängstigend wäre, diese Botschaft direkt zu sagen<br />
(z.B. Ärgerreaktion).<br />
- Es kann vorkommen, dass jemand prüft, ob der Gesprächspartner die versteckte<br />
Botschaft erkennt (d.h. empathisch genug ist).<br />
- Ebenso können verdeckte Botschaften in Form von Ironie gebraucht werden und<br />
damit die Beziehung zwischen Sender und Empfänger verschleiern helfen.<br />
- Die verdeckte Botschaft kann auch <strong>ein</strong>e erhöhte Wachsamkeit be<strong>im</strong> Empfänger<br />
bewirken.<br />
Die TA versteht unter <strong>ein</strong>er Serie von verdeckten Transaktionen mit vorhersagbarem Ende, d.h. regelhaften<br />
Kommunikationsmuster „Spiele“/ Games. In s<strong>ein</strong>em Buch „Spiele der Erwachsenen“ hat<br />
BERNE <strong>ein</strong>e ganze Menge solcher Spiele angeführt und besprochen. Damit Spiele durchgeführt<br />
werden bzw. greifen können, bedarf es <strong>im</strong>mer mindestens <strong>ein</strong>er zweiten Person. Die meisten Spiele<br />
bringen Ärger/ Konflikte. Alle Spiele haben ihren Ursprung in dem <strong>ein</strong>fachen Kinderspiel „M<strong>ein</strong>s ist<br />
besser als d<strong>ein</strong>s“. Wie HARRIS 85 in s<strong>ein</strong>em 7. Kapitel „Wie wir mit der Zeit umgehen“ ausführt, sind<br />
Spiele <strong>ein</strong>e von 6 Formen, Zeit zu strukturieren. Viele Menschen quält die Frage: „Wie komme ich<br />
über die nächste Stunde hinweg?“ Je mehr die Zeit strukturiert ist, um so weniger stellt sich diese<br />
Frage. Strukturhunger ist <strong>ein</strong>e Folge von Hunger nach Anerkennung, und je älter wir werden, umso<br />
mehr Wahlmöglichkeiten haben wir, diesen Hunger zu stillen. HARRIS führt sechs formale Erlebniskategorien<br />
an: Rückzug, Rituale, Aktivitäten, Zeitvertreib, Spiele und Int<strong>im</strong>ität. Alle 6 Kategorien<br />
an dieser Stelle näher zu beschreiben, würde zu weit führen. Abschließend sei kurz auf die Kategorie<br />
Spiele hingewiesen.<br />
Die von BERNE gewählten Spieltitel sind der Alltagssprache entnommen und die meisten legen<br />
mit semantischer Präzision den Finger auf das Hauptmerkmal des Spiels: z.B. „Ist es nicht schrecklich“;<br />
„Wenn du nicht wärst“; „Wer hat gewonnen“; „Jetzt hab ich dich endlich, du Schw<strong>ein</strong>ehund“;<br />
„Tu mir bitte nichts“; „Warum nicht – ja aber“ ; „Räuber und Gendarm“; „Ich will doch nur d<strong>ein</strong> Bestes“;<br />
„Glücklich zu helfen“; „In die Enge treiben“; „Groupie“ (oder „Oh, Sie sind wundervoll, Herr<br />
Professor“; etc …<br />
BERNE 86 hat wiederholte Verhaltens-, Denk- und Fühlmuster als Systeme von Spielregeln, Spielplänen,<br />
Eröffnungen, Spielzügen, Einsätzen, bis hin zum Spielende und dem Spielgewinn betrachtet.<br />
Er nahm Gefühle als ‚Währung’, Triumph und Enttäuschung als ‚Spielgewinn’. Und wie<br />
84 HENNIG Gudrun/ PELZ Georg; Transaktionsanalyse. Lehrbuch <strong>für</strong> Therapie und Beratung; Paderborn 2002, 47<br />
85 HARRIS 2004, 136ff<br />
86 vgl. BERNE 2004<br />
119