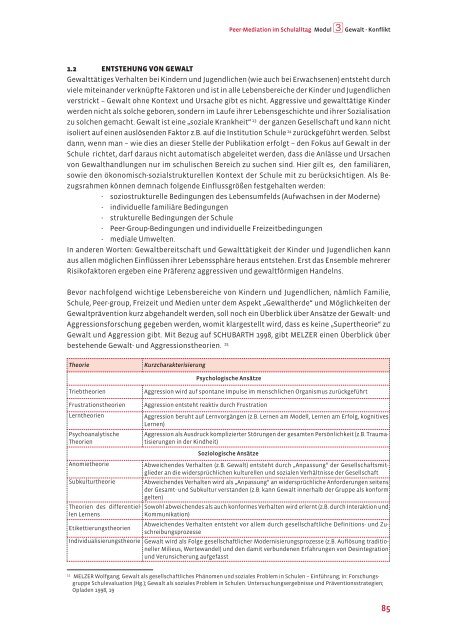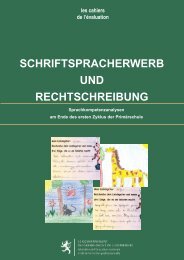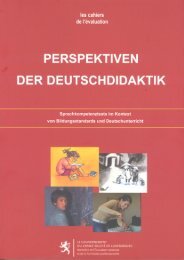Peer-Mediation im Schulalltag : ein Handbuch für Lehrer
Peer-Mediation im Schulalltag : ein Handbuch für Lehrer
Peer-Mediation im Schulalltag : ein Handbuch für Lehrer
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1.2 ENTSTEHUNG VON GEWALT<br />
Gewalttätiges Verhalten bei Kindern und Jugendlichen (wie auch bei Erwachsenen) entsteht durch<br />
viele mit<strong>ein</strong>ander verknüpfte Faktoren und ist in alle Lebensbereiche der Kinder und Jugendlichen<br />
verstrickt – Gewalt ohne Kontext und Ursache gibt es nicht. Aggressive und gewalttätige Kinder<br />
werden nicht als solche geboren, sondern <strong>im</strong> Laufe ihrer Lebensgeschichte und ihrer Sozialisation<br />
zu solchen gemacht. Gewalt ist <strong>ein</strong>e „soziale Krankheit“ 13 der ganzen Gesellschaft und kann nicht<br />
isoliert auf <strong>ein</strong>en auslösenden Faktor z.B. auf die Institution Schule 14 zurückgeführt werden. Selbst<br />
dann, wenn man – wie dies an dieser Stelle der Publikation erfolgt – den Fokus auf Gewalt in der<br />
Schule richtet, darf daraus nicht automatisch abgeleitet werden, dass die Anlässe und Ursachen<br />
von Gewalthandlungen nur <strong>im</strong> schulischen Bereich zu suchen sind. Hier gilt es, den familiären,<br />
sowie den ökonomisch-sozialstrukturellen Kontext der Schule mit zu berücksichtigen. Als Bezugsrahmen<br />
können demnach folgende Einflussgrößen festgehalten werden:<br />
- soziostrukturelle Bedingungen des Lebensumfelds (Aufwachsen in der Moderne)<br />
- individuelle familiäre Bedingungen<br />
- strukturelle Bedingungen der Schule<br />
- <strong>Peer</strong>-Group-Bedingungen und individuelle Freizeitbedingungen<br />
- mediale Umwelten.<br />
In anderen Worten: Gewaltbereitschaft und Gewalttätigkeit der Kinder und Jugendlichen kann<br />
aus allen möglichen Einflüssen ihrer Lebenssphäre heraus entstehen. Erst das Ensemble mehrerer<br />
Risikofaktoren ergeben <strong>ein</strong>e Präferenz aggressiven und gewaltförmigen Handelns.<br />
Bevor nachfolgend wichtige Lebensbereiche von Kindern und Jugendlichen, nämlich Familie,<br />
Schule, <strong>Peer</strong>-group, Freizeit und Medien unter dem Aspekt „Gewaltherde“ und Möglichkeiten der<br />
Gewaltprävention kurz abgehandelt werden, soll noch <strong>ein</strong> Überblick über Ansätze der Gewalt- und<br />
Aggressionsforschung gegeben werden, womit klargestellt wird, dass es k<strong>ein</strong>e „Supertheorie“ zu<br />
Gewalt und Aggression gibt. Mit Bezug auf SCHUBARTH 1998, gibt MELZER <strong>ein</strong>en Überblick über<br />
bestehende Gewalt- und Aggressionstheorien. 15<br />
Theorie Kurzcharakterisierung<br />
Psychologische Ansätze<br />
Triebtheorien Aggression wird auf spontane Impulse <strong>im</strong> menschlichen Organismus zurückgeführt<br />
Frustrationstheorien Aggression entsteht reaktiv durch Frustration<br />
Lerntheorien Aggression beruht auf Lernvorgängen (z.B. Lernen am Modell, Lernen am Erfolg, kognitives<br />
Lernen)<br />
Psychoanalytische<br />
Theorien<br />
Aggression als Ausdruck komplizierter Störungen der gesamten Persönlichkeit (z.B. Traumatisierungen<br />
in der Kindheit)<br />
Soziologische Ansätze<br />
Anomietheorie Abweichendes Verhalten (z.B. Gewalt) entsteht durch „Anpassung“ der Gesellschaftsmitglieder<br />
an die widersprüchlichen kulturellen und sozialen Verhältnisse der Gesellschaft<br />
Subkulturtheorie Abweichendes Verhalten wird als „Anpassung“ an widersprüchliche Anforderungen seitens<br />
der Gesamt- und Subkultur verstanden (z.B. kann Gewalt innerhalb der Gruppe als konform<br />
gelten)<br />
Theorien des differentiellen<br />
Lernens<br />
<strong>Peer</strong>-<strong>Mediation</strong> <strong>im</strong> <strong>Schulalltag</strong> Modul�Gewalt - Konflikt<br />
Sowohl abweichendes als auch konformes Verhalten wird erlernt (z.B. durch Interaktion und<br />
Kommunikation)<br />
Abweichendes Verhalten entsteht vor allem durch gesellschaftliche Definitions- und Zu-<br />
Etikettierungstheorien<br />
schreibungsprozesse<br />
Individualisierungstheorie Gewalt wird als Folge gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse (z.B. Auflösung traditioneller<br />
Milieus, Wertewandel) und den damit verbundenen Erfahrungen von Desintegration<br />
und Verunsicherung aufgefasst<br />
15 MELZER Wolfgang; Gewalt als gesellschaftliches Phänomen und soziales Problem in Schulen – Einführung; in: Forschungsgruppe<br />
Schulevaluation (Hg.); Gewalt als soziales Problem in Schulen. Untersuchungsergebnisse und Präventionsstrategien;<br />
Opladen 1998, 19<br />
85