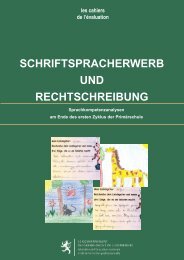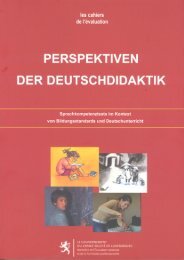Peer-Mediation im Schulalltag : ein Handbuch für Lehrer
Peer-Mediation im Schulalltag : ein Handbuch für Lehrer
Peer-Mediation im Schulalltag : ein Handbuch für Lehrer
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Peer</strong>-<strong>Mediation</strong> <strong>im</strong> <strong>Schulalltag</strong> Modul�Gewalt - Konflikt<br />
Missverständnis). Oder das Gesagte wird von beiden unterschiedlich emotional „besetzt“. Auch<br />
auf der Ebene non-verbaler Kommunikation kann <strong>ein</strong>iges passieren, denken wir nur <strong>ein</strong>mal daran,<br />
wenn be<strong>im</strong> Zuhören das Gegenüber den Blickkontakt unterbricht, oder be<strong>im</strong> Begrüßen der <strong>ein</strong>e<br />
der anderen nicht in die Augen schaut. Ganz zu schweigen bei widersprüchlichen Signalen zwischen<br />
verbaler und non-verbaler Kommunikation. SCHULZ von THUN oder WATZLAWICK (um nur<br />
zwei Autoren zu nennen, die bereits in dieser Publikation zum Thema Kommunikation zitiert wurden)<br />
verweisen mit ihren Büchern auf <strong>ein</strong>e Unzahl von Störungen, die durch Kommunikation entstehen<br />
können. Nachfolgend <strong>ein</strong> kurzer Auszug weiterer Hinweise, wie durch Kommunikation Konflikte<br />
aufkommen können:<br />
Viele Menschen stört es, wenn ihr Gegenüber „um den heißen Brei herumredet“ und<br />
klare Aussagen vermeidet (= amorpher Kommunikationsstil). Genauso wenig mögen Menschen,<br />
wenn ihnen das Gegenüber laufend ins Wort fällt, <strong>ein</strong>en nicht ausreden lässt, so dass letztlich k<strong>ein</strong>er<br />
s<strong>ein</strong>e Intention vollständig darstellen kann (= fragmentarischer Kommunikationsstil). Und<br />
wenn <strong>ein</strong> Partner s<strong>ein</strong> Verhalten nur auf das ihn störende Verhalten des anderen reduziert, ohne<br />
den Eigenanteil an dieser Situation zu sehen (= reaktiver Kommunikationsstil), also die Schuld<br />
<strong>im</strong>mer be<strong>im</strong> anderen sieht, führt das in aller Regel auch zu Konflikten. Ganz zu schweigen, wenn<br />
sich zwei Menschen gegenüberstehen und <strong>ein</strong>er die Kommunikation verweigert.<br />
Interessant wird es, wenn man versucht „tiefere“ Gründe <strong>für</strong> das Konfliktverhalten von<br />
Menschen zu erschließen. Stellen wir uns <strong>ein</strong>mal <strong>ein</strong>en Jugendlichen vor, der versucht <strong>im</strong> Spannungsfeld<br />
der Identitätsanforderungen „zu s<strong>ein</strong>, wie alle anderen“ und zugleich „zu s<strong>ein</strong>, wie k<strong>ein</strong><br />
anderer“. (An dieser Stelle ließe sich <strong>ein</strong> weiterer Ansatz darstellen, der symbolisch-interaktionistische.)<br />
Dieser Versuch, persönliche und gesellschaftliche Erwartungen unter <strong>ein</strong>en Hut zu bringen,<br />
d.h. die eigenen und die fremden Interessen mit<strong>ein</strong>ander ins Gleichgewicht zu bringen, ist <strong>ein</strong><br />
durchaus schwieriger Balanceakt, den wir Tag <strong>für</strong> Tag in der Schule und zu Hause erleben können:<br />
Pubertät heißt das Stichwort. Manchmal bekommen wir in diesem Zusammenhang zu hören: „ES<br />
ging mit ihm/ ihr durch!“<br />
2.2.2 Der psychoanalytische Ansatz<br />
Der psychoanalytischen Theorie zufolge werden vor allem in den ersten fünf Lebensjahren Eigenschaften<br />
erworben, die die typische Weise <strong>ein</strong>es Menschen mit s<strong>ein</strong>er Umwelt umzugehen best<strong>im</strong>men.<br />
Diese Eigenschaften haben <strong>ein</strong>en hohen Selbständigkeitswert, da sie in <strong>ein</strong>er Zeit erworben<br />
wurden, in der das Kind weitgehend nur in emotionaler Weise und nur beschränkt<br />
begrifflich auf s<strong>ein</strong>e Umwelt reagieren konnte. Sie sind kaum mehr erinnerbar (=unbewusst), best<strong>im</strong>men<br />
aber dennoch weitgehend die Reaktionen (auch) des (erwachsenen) Menschen auf s<strong>ein</strong>e<br />
Umwelt (Haltungen, Erwartungen, Bedürfnisse, …). Das Reservoir des Unbewussten, das in den ersten<br />
fünf Lebensjahren aus dem interpersonellen Erfahrungsbereich <strong>ein</strong>es Menschen gespeist und definiert<br />
wird, ist best<strong>im</strong>mend <strong>für</strong> s<strong>ein</strong>e Persönlichkeit und Grundhaltungen. Diese Antriebe, Bedürfnisse,<br />
Emotionen laufen also ab, ohne dass Einsicht oder Wille Wesentliches ändern könnten. Da<br />
diese Emotionen mit Erfahrungen in früher Kindheit gekoppelt werden, laufen auch be<strong>im</strong> erwachsenen<br />
Menschen diese Emotionen bei ähnlichen Erfahrungen ab: ES geht eben mit ihm/ihr durch!<br />
Einen anderen wichtigen Einfluss auf dieses Repertoire des Unbewussten haben Abwehrmechanismen.<br />
Abgewehrt werden Vorstellungen, mit denen <strong>ein</strong> Mensch nicht glaubt, leben<br />
zu können, weil sie etwa s<strong>ein</strong>e Identität gefährden, verletzen, in Frage stellen. Abwehrmechanismen<br />
sind etwa: Verdrängung, Verleugnung, Verschiebung, Verallgem<strong>ein</strong>erung, Projektion, Regression,<br />
Subl<strong>im</strong>ation oder Selbstbestrafung. Alle Formen der Abwehr haben das Ziel, Vorstellungen<br />
von Handlungen, Motiven, Wünschen, Hoffnungen erträglich, gar unerheblich oder vergeßbar zu<br />
machen. Problematisch sind diese Formen der Abwehr, weil sie inadäquate Formen der Konfliktbewältigung<br />
sind: eigentlich handelt es sich hierbei <strong>im</strong>mer um Flucht!<br />
113