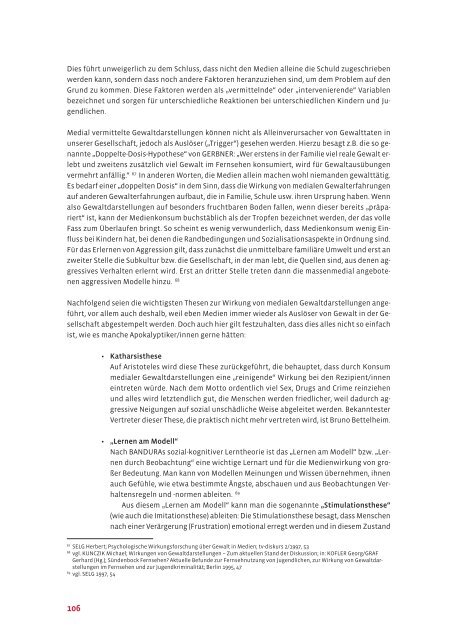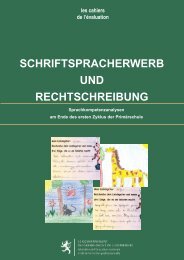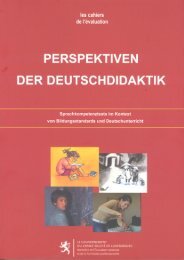Peer-Mediation im Schulalltag : ein Handbuch für Lehrer
Peer-Mediation im Schulalltag : ein Handbuch für Lehrer
Peer-Mediation im Schulalltag : ein Handbuch für Lehrer
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Dies führt unweigerlich zu dem Schluss, dass nicht den Medien all<strong>ein</strong>e die Schuld zugeschrieben<br />
werden kann, sondern dass noch andere Faktoren heranzuziehen sind, um dem Problem auf den<br />
Grund zu kommen. Diese Faktoren werden als „vermittelnde“ oder „intervenierende“ Variablen<br />
bezeichnet und sorgen <strong>für</strong> unterschiedliche Reaktionen bei unterschiedlichen Kindern und Jugendlichen.<br />
Medial vermittelte Gewaltdarstellungen können nicht als All<strong>ein</strong>verursacher von Gewalttaten in<br />
unserer Gesellschaft, jedoch als Auslöser („Trigger“) gesehen werden. Hierzu besagt z.B. die so genannte<br />
„Doppelte-Dosis-Hypothese“ von GERBNER: „Wer erstens in der Familie viel reale Gewalt erlebt<br />
und zweitens zusätzlich viel Gewalt <strong>im</strong> Fernsehen konsumiert, wird <strong>für</strong> Gewaltausübungen<br />
vermehrt anfällig.“ 67 In anderen Worten, die Medien all<strong>ein</strong> machen wohl niemanden gewalttätig.<br />
Es bedarf <strong>ein</strong>er „doppelten Dosis“ in dem Sinn, dass die Wirkung von medialen Gewalterfahrungen<br />
auf anderen Gewalterfahrungen aufbaut, die in Familie, Schule usw. ihren Ursprung haben. Wenn<br />
also Gewaltdarstellungen auf besonders fruchtbaren Boden fallen, wenn dieser bereits „präpariert“<br />
ist, kann der Medienkonsum buchstäblich als der Tropfen bezeichnet werden, der das volle<br />
Fass zum Überlaufen bringt. So sch<strong>ein</strong>t es wenig verwunderlich, dass Medienkonsum wenig Einfluss<br />
bei Kindern hat, bei denen die Randbedingungen und Sozialisationsaspekte in Ordnung sind.<br />
Für das Erlernen von Aggression gilt, dass zunächst die unmittelbare familiäre Umwelt und erst an<br />
zweiter Stelle die Subkultur bzw. die Gesellschaft, in der man lebt, die Quellen sind, aus denen aggressives<br />
Verhalten erlernt wird. Erst an dritter Stelle treten dann die massenmedial angebotenen<br />
aggressiven Modelle hinzu. 68<br />
Nachfolgend seien die wichtigsten Thesen zur Wirkung von medialen Gewaltdarstellungen angeführt,<br />
vor allem auch deshalb, weil eben Medien <strong>im</strong>mer wieder als Auslöser von Gewalt in der Gesellschaft<br />
abgestempelt werden. Doch auch hier gilt festzuhalten, dass dies alles nicht so <strong>ein</strong>fach<br />
ist, wie es manche Apokalyptiker/innen gerne hätten:<br />
106<br />
• Katharsisthese<br />
Auf Aristoteles wird diese These zurückgeführt, die behauptet, dass durch Konsum<br />
medialer Gewaltdarstellungen <strong>ein</strong>e „r<strong>ein</strong>igende“ Wirkung bei den Rezipient/innen<br />
<strong>ein</strong>treten würde. Nach dem Motto ordentlich viel Sex, Drugs and Cr<strong>im</strong>e r<strong>ein</strong>ziehen<br />
und alles wird letztendlich gut, die Menschen werden friedlicher, weil dadurch aggressive<br />
Neigungen auf sozial unschädliche Weise abgeleitet werden. Bekanntester<br />
Vertreter dieser These, die praktisch nicht mehr vertreten wird, ist Bruno Bettelhe<strong>im</strong>.<br />
• „Lernen am Modell“<br />
Nach BANDURAs sozial-kognitiver Lerntheorie ist das „Lernen am Modell“ bzw. „Lernen<br />
durch Beobachtung“ <strong>ein</strong>e wichtige Lernart und <strong>für</strong> die Medienwirkung von großer<br />
Bedeutung. Man kann von Modellen M<strong>ein</strong>ungen und Wissen übernehmen, ihnen<br />
auch Gefühle, wie etwa best<strong>im</strong>mte Ängste, abschauen und aus Beobachtungen Verhaltensregeln<br />
und -normen ableiten. 69<br />
Aus diesem „Lernen am Modell“ kann man die sogenannte „St<strong>im</strong>ulationsthese“<br />
(wie auch die Imitationsthese) ableiten: Die St<strong>im</strong>ulationsthese besagt, dass Menschen<br />
nach <strong>ein</strong>er Verärgerung (Frustration) emotional erregt werden und in diesem Zustand<br />
67 SELG Herbert; Psychologische Wirkungsforschung über Gewalt in Medien; tv-diskurs 2/1997, 53<br />
68 vgl. KUNCZIK Michael; Wirkungen von Gewaltdarstellungen – Zum aktuellen Stand der Diskussion; in: KOFLER Georg/GRAF<br />
Gerhard (Hg.); Sündenbock Fernsehen? Aktuelle Befunde zur Fernsehnutzung von Jugendlichen, zur Wirkung von Gewaltdarstellungen<br />
<strong>im</strong> Fernsehen und zur Jugendkr<strong>im</strong>inalität; Berlin 1995, 47<br />
69 vgl. SELG 1997, 54