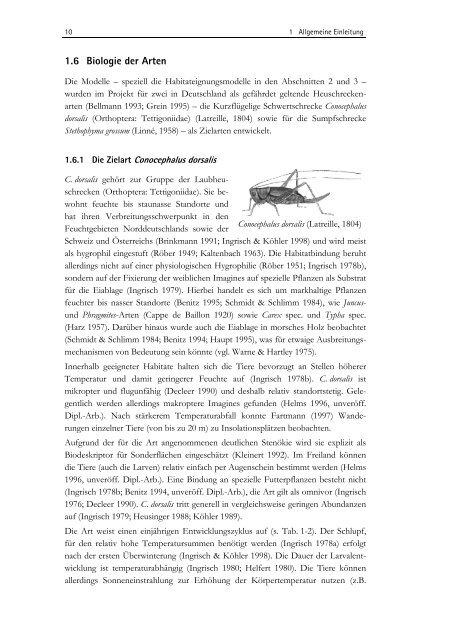Zwischen Naturschutz und Theoretischer Ökologie: Modelle zur ...
Zwischen Naturschutz und Theoretischer Ökologie: Modelle zur ...
Zwischen Naturschutz und Theoretischer Ökologie: Modelle zur ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
10 1 Allgemeine Einleitung<br />
1.6 Biologie der Arten<br />
Die <strong>Modelle</strong> – speziell die Habitateignungsmodelle in den Abschnitten 2 <strong>und</strong> 3 –<br />
wurden im Projekt für zwei in Deutschland als gefährdet geltende Heuschreckenarten<br />
(Bellmann 1993; Grein 1995) – die Kurzflügelige Schwertschrecke Conocephalus<br />
dorsalis (Orthoptera: Tettigoniidae) (Latreille, 1804) sowie für die Sumpfschrecke<br />
Stethophyma grossum (Linné, 1958) – als Zielarten entwickelt.<br />
1.6.1 Die Zielart Conocephalus dorsalis<br />
C. dorsalis gehört <strong>zur</strong> Gruppe der Laubheuschrecken<br />
(Orthoptera: Tettigoniidae). Sie bewohnt<br />
feuchte bis staunasse Standorte <strong>und</strong><br />
hat ihren Verbreitungsschwerpunkt in den<br />
Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804)<br />
Feuchtgebieten Norddeutschlands sowie der<br />
Schweiz <strong>und</strong> Österreichs (Brinkmann 1991; Ingrisch & Köhler 1998) <strong>und</strong> wird meist<br />
als hygrophil eingestuft (Röber 1949; Kaltenbach 1963). Die Habitatbindung beruht<br />
allerdings nicht auf einer physiologischen Hygrophilie (Röber 1951; Ingrisch 1978b),<br />
sondern auf der Fixierung der weiblichen Imagines auf spezielle Pflanzen als Substrat<br />
für die Eiablage (Ingrisch 1979). Hierbei handelt es sich um markhaltige Pflanzen<br />
feuchter bis nasser Standorte (Benitz 1995; Schmidt & Schlimm 1984), wie Juncus<strong>und</strong><br />
Phragmites-Arten (Cappe de Baillon 1920) sowie Carex spec. <strong>und</strong> Typha spec.<br />
(Harz 1957). Darüber hinaus wurde auch die Eiablage in morsches Holz beobachtet<br />
(Schmidt & Schlimm 1984; Benitz 1994; Haupt 1995), was für etwaige Ausbreitungsmechanismen<br />
von Bedeutung sein könnte (vgl. Warne & Hartley 1975).<br />
Innerhalb geeigneter Habitate halten sich die Tiere bevorzugt an Stellen höherer<br />
Temperatur <strong>und</strong> damit geringerer Feuchte auf (Ingrisch 1978b). C. dorsalis ist<br />
mikropter <strong>und</strong> flugunfähig (Decleer 1990) <strong>und</strong> deshalb relativ standortstetig. Gelegentlich<br />
werden allerdings makroptere Imagines gef<strong>und</strong>en (Helms 1996, unveröff.<br />
Dipl.-Arb.). Nach stärkerem Temperaturabfall konnte Fartmann (1997) Wanderungen<br />
einzelner Tiere (von bis zu 20 m) zu Insolationsplätzen beobachten.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der für die Art angenommenen deutlichen Stenökie wird sie explizit als<br />
Biodeskriptor für Sonderflächen eingeschätzt (Kleinert 1992). Im Freiland können<br />
die Tiere (auch die Larven) relativ einfach per Augenschein bestimmt werden (Helms<br />
1996, unveröff. Dipl.-Arb.). Eine Bindung an spezielle Futterpflanzen besteht nicht<br />
(Ingrisch 1978b; Benitz 1994, unveröff. Dipl.-Arb.), die Art gilt als omnivor (Ingrisch<br />
1976; Decleer 1990). C. dorsalis tritt generell in vergleichsweise geringen Ab<strong>und</strong>anzen<br />
auf (Ingrisch 1979; Heusinger 1988; Köhler 1989).<br />
Die Art weist einen einjährigen Entwicklungszyklus auf (s. Tab. 1-2). Der Schlupf,<br />
für den relativ hohe Temperatursummen benötigt werden (Ingrisch 1978a) erfolgt<br />
nach der ersten Überwinterung (Ingrisch & Köhler 1998). Die Dauer der Larvalentwicklung<br />
ist temperaturabhängig (Ingrisch 1980; Helfert 1980). Die Tiere können<br />
allerdings Sonneneinstrahlung <strong>zur</strong> Erhöhung der Körpertemperatur nutzen (z.B.