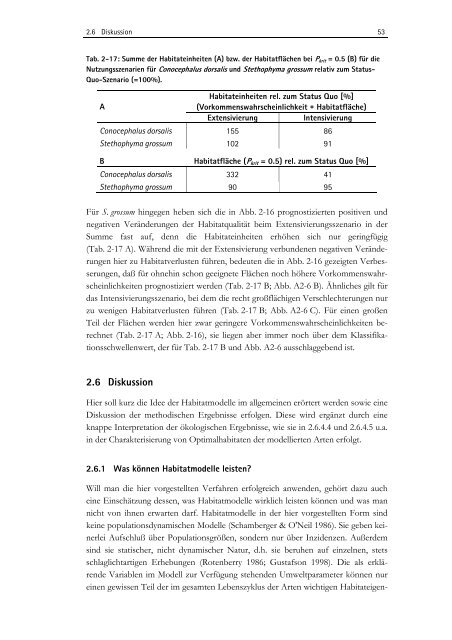Zwischen Naturschutz und Theoretischer Ökologie: Modelle zur ...
Zwischen Naturschutz und Theoretischer Ökologie: Modelle zur ...
Zwischen Naturschutz und Theoretischer Ökologie: Modelle zur ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2.6 Diskussion 53<br />
Tab. 2-17: Summe der Habitateinheiten (A) bzw. der Habitatflächen bei Pkrit = 0.5 (B) für die<br />
Nutzungsszenarien für Conocephalu s dorsalis <strong>und</strong> Stethophyma grossum relativ zum Status-<br />
Quo-Szenario (=100%).<br />
A<br />
Habitateinheiten rel. zum Status Quo [%]<br />
(Vorkommenswahrscheinlichkeit ∗ Habitatfläche)<br />
Extensivierung Intensivierung<br />
Conocephalus dorsalis 155 86<br />
Stethophyma grossum 102 91<br />
B Habitatfläche (Pkrit = 0.5) rel. zum Status Quo [%]<br />
Conocephalus dorsalis 332 41<br />
Stethophyma grossum 90 95<br />
Für S. grossum hingegen heben sich die in Abb. 2-16 prognostizierten positiven <strong>und</strong><br />
negativen Veränderungen der Habitatqualität beim Extensivierungsszenario in der<br />
Summe fast auf, denn die Habitateinheiten erhöhen sich nur geringfügig<br />
(Tab. 2-17 A). Während die mit der Extensivierung verb<strong>und</strong>enen negativen Veränderungen<br />
hier zu Habitatverlusten führen, bedeuten die in Abb. 2-16 gezeigten Verbesserungen,<br />
daß für ohnehin schon geeignete Flächen noch höhere Vorkommenswahrscheinlichkeiten<br />
prognostiziert werden (Tab. 2-17 B; Abb. A2-6 B). Ähnliches gilt für<br />
das Intensivierungsszenario, bei dem die recht großflächigen Verschlechterungen nur<br />
zu wenigen Habitatverlusten führen (Tab. 2-17 B; Abb. A2-6 C). Für einen großen<br />
Teil der Flächen werden hier zwar geringere Vorkommenswahrscheinlichkeiten berechnet<br />
(Tab. 2-17 A; Abb. 2-16), sie liegen aber immer noch über dem Klassifikationsschwellenwert,<br />
der für Tab. 2-17 B <strong>und</strong> Abb. A2-6 ausschlaggebend ist.<br />
2.6 Diskussion<br />
Hier soll kurz die Idee der Habitatmodelle im allgemeinen erörtert werden sowie eine<br />
Diskussion der methodischen Ergebnisse erfolgen. Diese wird ergänzt durch eine<br />
knappe Interpretation der ökologischen Ergebnisse, wie sie in 2.6.4.4 <strong>und</strong> 2.6.4.5 u.a.<br />
in der Charakterisierung von Optimalhabitaten der modellierten Arten erfolgt.<br />
2.6.1 Was können Habitatmodelle leisten?<br />
Will man die hier vorgestellten Verfahren erfolgreich anwenden, gehört dazu auch<br />
eine Einschätzung dessen, was Habitatmodelle wirklich leisten können <strong>und</strong> was man<br />
nicht von ihnen erwarten darf. Habitatmodelle in der hier vorgestellten Form sind<br />
keine populationsdynamischen <strong>Modelle</strong> (Schamberger & O'Neil 1986). Sie geben keinerlei<br />
Aufschluß über Populationsgrößen, sondern nur über Inzidenzen. Außerdem<br />
sind sie statischer, nicht dynamischer Natur, d.h. sie beruhen auf einzelnen, stets<br />
schlaglichtartigen Erhebungen (Rotenberry 1986; Gustafson 1998). Die als erklärende<br />
Variablen im Modell <strong>zur</strong> Verfügung stehenden Umweltparameter können nur<br />
einen gewissen Teil der im gesamten Lebenszyklus der Arten wichtigen Habitateigen-