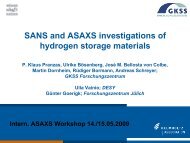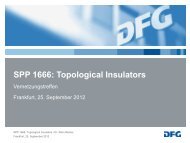ASAXS - Helmholtz-Zentrum Berlin
ASAXS - Helmholtz-Zentrum Berlin
ASAXS - Helmholtz-Zentrum Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
8.6 Zusammenfassung des Strukturmodells der Oxyfluorid-Glaskeramik<br />
Daten zur Verfügung stehen, gibt es eine gute Übereinstimmung zwischen Experiment und<br />
Simulation. Darüber hinaus zeigt die Simulation den tatsächlich zu erwartenden Verlauf der<br />
differenziellen Streuquerschnitte in den Bereichen, in denen keine experimentellen Daten zur<br />
Verfügung stehen. Es sind deutlich alle L3, L2 und L1 Röntgenabsorptionskanten der Elemente<br />
Er, Yb und Pb zu erkennen (horizontale Linien).<br />
Die Abweichungen im Verlauf der Isolinien bei großen Streuvektorbeträgen ist auf den<br />
Einfluss der Untergrundstreuung zurückzuführen. Die Simulation wurde komplett ohne Untergrundstreuung<br />
berechnet, wohingegen der A-Plot des Experimentes diesen Beitrag noch<br />
beinhaltet.<br />
Nach der geplanten Korrektur und Kalibrierung der Nachmessungen wird erwartet, dass<br />
der A-Plot des Experimentes in guter Näherung dem der Simulation entspricht. Die dennoch<br />
bereits gute Übereinstimmung lässt den Schluss zu, dass das abgeleitete Strukturmodell<br />
die experimentellen Daten im Bereich der jeweiligen Messfehler hinreichend gut beschreibt.<br />
Anderenfalls müsste das Strukturmodell als falsch angesehen werden.<br />
8.6 Zusammenfassung des Strukturmodells der<br />
Oxyfluorid-Glaskeramik<br />
In Abbildung 8.18 sind die Ergebnisse der quantitativen Auswertung der getemperten Probe<br />
S3 schematisch dargestellt. Die Nanostruktur lässt sich in erster Näherung durch Rotationsellipsoide<br />
mit einer Dimension von 17.7±3.9 nm für die lange Achse und 6.4±1.4 nm für die kurze<br />
Achse beschreiben. Des Weiteren musste für die theoretische Modellierung der differenziellen<br />
Streuquerschnitte eine interpartikuläre Wechselwirkung in Form eines virtuellen Abstoßungsteilchens<br />
mit der Dimension 8.2 ± 1.4 nm angenommen werden. Andere Strukturmodelle, wie<br />
beispielsweise ein Kern-Hülle Rotationsellipsoid oder Ellipsoid, konnten ausgeschlossen werden.<br />
Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass es möglich ist, sowohl die Polydispersität als<br />
auch die Exzentrizität simultan aus einem <strong>ASAXS</strong>-Experiment zu bestimmen. Die berechneten<br />
Größen der Nanopartikel stimmen mit den Werten aus den XRD Untersuchungen [101]<br />
unter Berücksichtigung der Fehler überein.<br />
Die quantitative Auswertung der Energieabhängigkeit des experimentell bestimmten Streukontrastes<br />
lieferte die Zusammensetzung der Glasmatrix sowie der Nanopartikel. Die gemittelte<br />
Zusammensetzung der Nanopartikel ist Pb0.17Yb0.17Er0.02F0.64. Es konnte demzufolge<br />
gezeigt werden, dass das Cadmium kein Bestandteil der Teilchenphase ist. Diese Erkenntnis<br />
ist in Übereinstimmung mit den Beobachtungen der XANES- sowie XRD-Messungen. In<br />
Abbildung 8.18 sind die jeweiligen Zusammensetzungen der beiden Phasen in einem Balkendiagramm<br />
illustriert. Da es möglich ist, den Verlauf des Streukontrastes theoretisch zu beschreiben,<br />
und die Parameter physikalisch-chemisch sinnvolle Werte annehmen, kann davon<br />
ausgegangen werden, dass das approximierte Strukturmodell eine gewisse Gültigkeit hat.<br />
Die Ergebnisse der nanochemischen Zusammensetzungsanalyse bestätigen die Behauptung<br />
von Kukkonen et al., dass es sich um ein Mischkristall von PbF2, ErF3 sowie YbF3 handelt.<br />
Die anfängliche Strukturvorstellung von Wang et al., dass es ein PbxCd1−xF2 Kristall ist<br />
konnte eindeutig widerlegt werden.<br />
Die qualitative Diskussion der möglichen Elektronendichteprofile eines Zweiphasenmodells<br />
bestätigt die quantitativen Ergebnisse der <strong>ASAXS</strong>-Auswertung.<br />
Es bleiben noch einige Fragen unbeantwortet: zum einem die genaue Funktion des Cadmiums,<br />
welches in der Glasmatrix eingebaut ist, in Bezug auf die Nukleation sowie die einsetzende<br />
Kristallisation bei Temperung der Gläser bei Temperaturen oberhalb der Glastransitionstemperatur<br />
von 390 ◦ C. Weiterführende Untersuchungen von Gläsern mit weniger oder keinem<br />
Cadmium könnten nützliche Erkenntnisse auf diesem Gebiet liefern.<br />
117