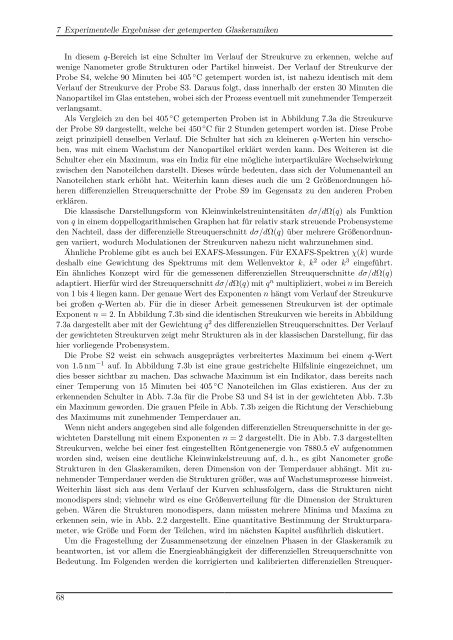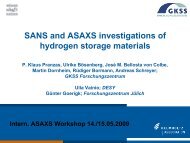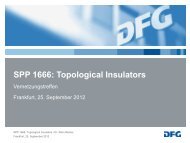ASAXS - Helmholtz-Zentrum Berlin
ASAXS - Helmholtz-Zentrum Berlin
ASAXS - Helmholtz-Zentrum Berlin
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
7 Experimentelle Ergebnisse der getemperten Glaskeramiken<br />
In diesem q-Bereich ist eine Schulter im Verlauf der Streukurve zu erkennen, welche auf<br />
wenige Nanometer große Strukturen oder Partikel hinweist. Der Verlauf der Streukurve der<br />
Probe S4, welche 90 Minuten bei 405 ◦ C getempert worden ist, ist nahezu identisch mit dem<br />
Verlauf der Streukurve der Probe S3. Daraus folgt, dass innerhalb der ersten 30 Minuten die<br />
Nanopartikel im Glas entstehen, wobei sich der Prozess eventuell mit zunehmender Temperzeit<br />
verlangsamt.<br />
Als Vergleich zu den bei 405 ◦ C getemperten Proben ist in Abbildung 7.3a die Streukurve<br />
der Probe S9 dargestellt, welche bei 450 ◦ C für 2 Stunden getempert worden ist. Diese Probe<br />
zeigt prinzipiell denselben Verlauf. Die Schulter hat sich zu kleineren q-Werten hin verschoben,<br />
was mit einem Wachstum der Nanopartikel erklärt werden kann. Des Weiteren ist die<br />
Schulter eher ein Maximum, was ein Indiz für eine mögliche interpartikuläre Wechselwirkung<br />
zwischen den Nanoteilchen darstellt. Dieses würde bedeuten, dass sich der Volumenanteil an<br />
Nanoteilchen stark erhöht hat. Weiterhin kann dieses auch die um 2 Größenordnungen höheren<br />
differenziellen Streuquerschnitte der Probe S9 im Gegensatz zu den anderen Proben<br />
erklären.<br />
Die klassische Darstellungsform von Kleinwinkelstreuintensitäten dσ/dΩ(q) als Funktion<br />
von q in einem doppellogarithmischen Graphen hat für relativ stark streuende Probensysteme<br />
den Nachteil, dass der differenzielle Streuquerschnitt dσ/dΩ(q) über mehrere Größenordnungen<br />
variiert, wodurch Modulationen der Streukurven nahezu nicht wahrzunehmen sind.<br />
Ähnliche Probleme gibt es auch bei EXAFS-Messungen. Für EXAFS-Spektren χ(k) wurde<br />
deshalb eine Gewichtung des Spektrums mit dem Wellenvektor k, k 2 oder k 3 eingeführt.<br />
Ein ähnliches Konzept wird für die gemessenen differenziellen Streuquerschnitte dσ/dΩ(q)<br />
adaptiert. Hierfür wird der Streuquerschnitt dσ/dΩ(q) mit q n multipliziert, wobei n im Bereich<br />
von 1 bis 4 liegen kann. Der genaue Wert des Exponenten n hängt vom Verlauf der Streukurve<br />
bei großen q-Werten ab. Für die in dieser Arbeit gemessenen Streukurven ist der optimale<br />
Exponent n = 2. In Abbildung 7.3b sind die identischen Streukurven wie bereits in Abbildung<br />
7.3a dargestellt aber mit der Gewichtung q 2 des differenziellen Streuquerschnittes. Der Verlauf<br />
der gewichteten Streukurven zeigt mehr Strukturen als in der klassischen Darstellung, für das<br />
hier vorliegende Probensystem.<br />
Die Probe S2 weist ein schwach ausgeprägtes verbreitertes Maximum bei einem q-Wert<br />
von 1.5 nm −1 auf. In Abbildung 7.3b ist eine graue gestrichelte Hilfslinie eingezeichnet, um<br />
dies besser sichtbar zu machen. Das schwache Maximum ist ein Indikator, dass bereits nach<br />
einer Temperung von 15 Minuten bei 405 ◦ C Nanoteilchen im Glas existieren. Aus der zu<br />
erkennenden Schulter in Abb. 7.3a für die Probe S3 und S4 ist in der gewichteten Abb. 7.3b<br />
ein Maximum geworden. Die grauen Pfeile in Abb. 7.3b zeigen die Richtung der Verschiebung<br />
des Maximums mit zunehmender Temperdauer an.<br />
Wenn nicht anders angegeben sind alle folgenden differenziellen Streuquerschnitte in der gewichteten<br />
Darstellung mit einem Exponenten n = 2 dargestellt. Die in Abb. 7.3 dargestellten<br />
Streukurven, welche bei einer fest eingestellten Röntgenenergie von 7880.5 eV aufgenommen<br />
worden sind, weisen eine deutliche Kleinwinkelstreuung auf, d. h., es gibt Nanometer große<br />
Strukturen in den Glaskeramiken, deren Dimension von der Temperdauer abhängt. Mit zunehmender<br />
Temperdauer werden die Strukturen größer, was auf Wachstumsprozesse hinweist.<br />
Weiterhin lässt sich aus dem Verlauf der Kurven schlussfolgern, dass die Strukturen nicht<br />
monodispers sind; vielmehr wird es eine Größenverteilung für die Dimension der Strukturen<br />
geben. Wären die Strukturen monodispers, dann müssten mehrere Minima und Maxima zu<br />
erkennen sein, wie in Abb. 2.2 dargestellt. Eine quantitative Bestimmung der Strukturparameter,<br />
wie Größe und Form der Teilchen, wird im nächsten Kapitel ausführlich diskutiert.<br />
Um die Fragestellung der Zusammensetzung der einzelnen Phasen in der Glaskeramik zu<br />
beantworten, ist vor allem die Energieabhängigkeit der differenziellen Streuquerschnitte von<br />
Bedeutung. Im Folgenden werden die korrigierten und kalibrierten differenziellen Streuquer-<br />
68