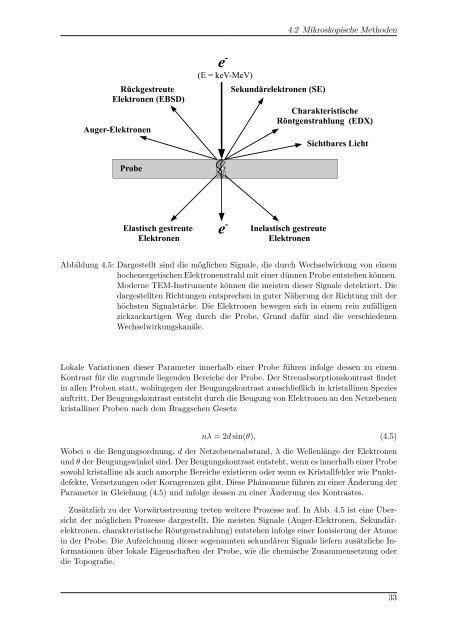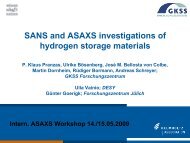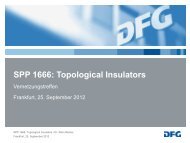ASAXS - Helmholtz-Zentrum Berlin
ASAXS - Helmholtz-Zentrum Berlin
ASAXS - Helmholtz-Zentrum Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Rückgestreute<br />
Elektronen (EBSD)<br />
Auger-Elektronen<br />
Probe<br />
Elastisch gestreute<br />
Elektronen<br />
e -<br />
(E = keV-MeV)<br />
e -<br />
Sekundärelektronen (SE)<br />
4.2 Mikroskopische Methoden<br />
Charakteristische<br />
Röntgenstrahlung (EDX)<br />
Inelastisch gestreute<br />
Elektronen<br />
Sichtbares Licht<br />
Abbildung 4.5: Dargestellt sind die möglichen Signale, die durch Wechselwirkung von einem<br />
hochenergetischen Elektronenstrahl mit einer dünnen Probe entstehen können.<br />
Moderne TEM-Instrumente können die meisten dieser Signale detektiert. Die<br />
dargestellten Richtungen entsprechen in guter Näherung der Richtung mit der<br />
höchsten Signalstärke. Die Elektronen bewegen sich in einem rein zufälligen<br />
zickzackartigen Weg durch die Probe. Grund dafür sind die verschiedenen<br />
Wechselwirkungskanäle.<br />
Lokale Variationen dieser Parameter innerhalb einer Probe führen infolge dessen zu einem<br />
Kontrast für die zugrunde liegenden Bereiche der Probe. Der Streuabsorptionskontrast findet<br />
in allen Proben statt, wohingegen der Beugungskontrast ausschließlich in kristallinen Spezies<br />
auftritt. Der Beugungskontrast entsteht durch die Beugung von Elektronen an den Netzebenen<br />
kristalliner Proben nach dem Braggschen Gesetz<br />
nλ = 2d sin(θ). (4.5)<br />
Wobei n die Beugungsordnung, d der Netzebenenabstand, λ die Wellenlänge der Elektronen<br />
und θ der Beugungswinkel sind. Der Beugungskontrast entsteht, wenn es innerhalb einer Probe<br />
sowohl kristalline als auch amorphe Bereiche existieren oder wenn es Kristallfehler wie Punktdefekte,<br />
Versetzungen oder Korngrenzen gibt. Diese Phänomene führen zu einer Änderung der<br />
Parameter in Gleichung (4.5) und infolge dessen zu einer Änderung des Kontrastes.<br />
Zusätzlich zu der Vorwärtsstreuung treten weitere Prozesse auf. In Abb. 4.5 ist eine Übersicht<br />
der möglichen Prozesse dargestellt. Die meisten Signale (Auger-Elektronen, Sekundärelektronen,<br />
charakteristische Röntgenstrahlung) entstehen infolge einer Ionisierung der Atome<br />
in der Probe. Die Aufzeichnung dieser sogenannten sekundären Signale liefern zusätzliche Informationen<br />
über lokale Eigenschaften der Probe, wie die chemische Zusammensetzung oder<br />
die Topografie.<br />
33