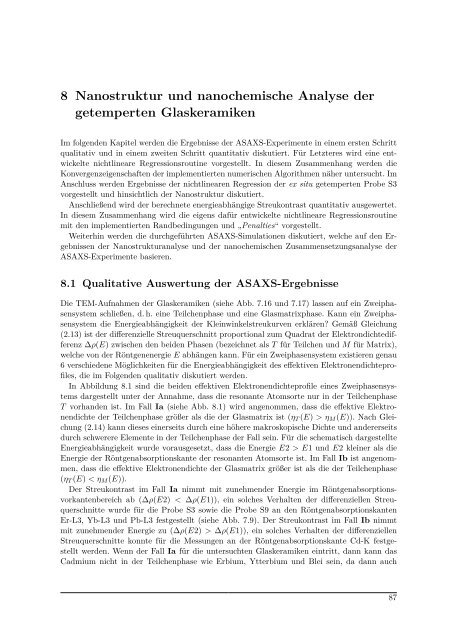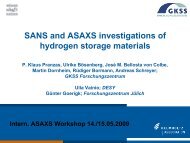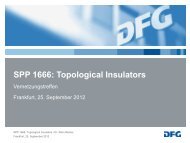ASAXS - Helmholtz-Zentrum Berlin
ASAXS - Helmholtz-Zentrum Berlin
ASAXS - Helmholtz-Zentrum Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
8 Nanostruktur und nanochemische Analyse der<br />
getemperten Glaskeramiken<br />
Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der <strong>ASAXS</strong>-Experimente in einem ersten Schritt<br />
qualitativ und in einem zweiten Schritt quantitativ diskutiert. Für Letzteres wird eine entwickelte<br />
nichtlineare Regressionsroutine vorgestellt. In diesem Zusammenhang werden die<br />
Konvergenzeigenschaften der implementierten numerischen Algorithmen näher untersucht. Im<br />
Anschluss werden Ergebnisse der nichtlinearen Regression der ex situ getemperten Probe S3<br />
vorgestellt und hinsichtlich der Nanostruktur diskutiert.<br />
Anschließend wird der berechnete energieabhängige Streukontrast quantitativ ausgewertet.<br />
In diesem Zusammenhang wird die eigens dafür entwickelte nichtlineare Regressionsroutine<br />
mit den implementierten Randbedingungen und „Penalties“ vorgestellt.<br />
Weiterhin werden die durchgeführten <strong>ASAXS</strong>-Simulationen diskutiert, welche auf den Ergebnissen<br />
der Nanostrukturanalyse und der nanochemischen Zusammensetzungsanalyse der<br />
<strong>ASAXS</strong>-Experimente basieren.<br />
8.1 Qualitative Auswertung der <strong>ASAXS</strong>-Ergebnisse<br />
Die TEM-Aufnahmen der Glaskeramiken (siehe Abb. 7.16 und 7.17) lassen auf ein Zweiphasensystem<br />
schließen, d. h. eine Teilchenphase und eine Glasmatrixphase. Kann ein Zweiphasensystem<br />
die Energieabhängigkeit der Kleinwinkelstreukurven erklären? Gemäß Gleichung<br />
(2.13) ist der differenzielle Streuquerschnitt proportional zum Quadrat der Elektrondichtedifferenz<br />
∆ρ(E) zwischen den beiden Phasen (bezeichnet als T für Teilchen und M für Matrix),<br />
welche von der Röntgenenergie E abhängen kann. Für ein Zweiphasensystem existieren genau<br />
6 verschiedene Möglichkeiten für die Energieabhängigkeit des effektiven Elektronendichteprofiles,<br />
die im Folgenden qualitativ diskutiert werden.<br />
In Abbildung 8.1 sind die beiden effektiven Elektronendichteprofile eines Zweiphasensystems<br />
dargestellt unter der Annahme, dass die resonante Atomsorte nur in der Teilchenphase<br />
T vorhanden ist. Im Fall Ia (siehe Abb. 8.1) wird angenommen, dass die effektive Elektronendichte<br />
der Teilchenphase größer als die der Glasmatrix ist (ηT (E) > ηM(E)). Nach Gleichung<br />
(2.14) kann dieses einerseits durch eine höhere makroskopische Dichte und andererseits<br />
durch schwerere Elemente in der Teilchenphase der Fall sein. Für die schematisch dargestellte<br />
Energieabhängigkeit wurde vorausgesetzt, dass die Energie E2 > E1 und E2 kleiner als die<br />
Energie der Röntgenabsorptionskante der resonanten Atomsorte ist. Im Fall Ib ist angenommen,<br />
dass die effektive Elektronendichte der Glasmatrix größer ist als die der Teilchenphase<br />
(ηT (E) < ηM(E)).<br />
Der Streukontrast im Fall Ia nimmt mit zunehmender Energie im Röntgenabsorptionsvorkantenbereich<br />
ab (∆ρ(E2) < ∆ρ(E1)), ein solches Verhalten der differenziellen Streuquerschnitte<br />
wurde für die Probe S3 sowie die Probe S9 an den Röntgenabsorptionskanten<br />
Er-L3, Yb-L3 und Pb-L3 festgestellt (siehe Abb. 7.9). Der Streukontrast im Fall Ib nimmt<br />
mit zunehmender Energie zu (∆ρ(E2) > ∆ρ(E1)), ein solches Verhalten der differenziellen<br />
Streuquerschnitte konnte für die Messungen an der Röntgenabsorptionskante Cd-K festgestellt<br />
werden. Wenn der Fall Ia für die untersuchten Glaskeramiken eintritt, dann kann das<br />
Cadmium nicht in der Teilchenphase wie Erbium, Ytterbium und Blei sein, da dann auch<br />
87