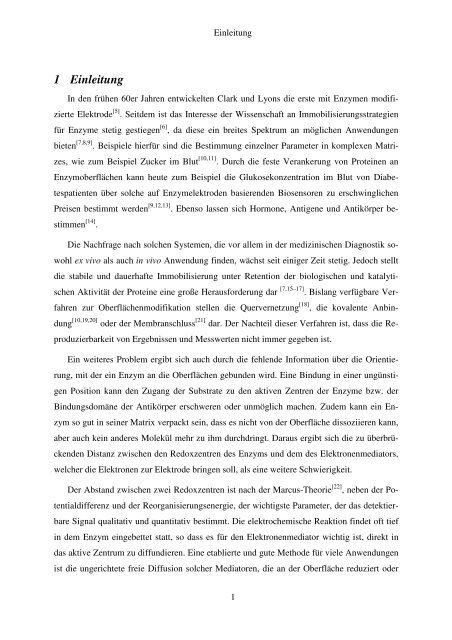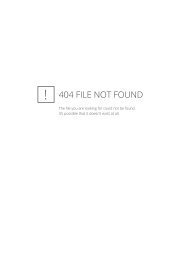Immobilisierung
resolver
resolver
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Einleitung<br />
1 Einleitung<br />
In den frühen 60er Jahren entwickelten Clark und Lyons die erste mit Enzymen modifizierte<br />
Elektrode [5] . Seitdem ist das Interesse der Wissenschaft an <strong>Immobilisierung</strong>sstrategien<br />
für Enzyme stetig gestiegen [6] , da diese ein breites Spektrum an möglichen Anwendungen<br />
bieten [7,8,9] . Beispiele hierfür sind die Bestimmung einzelner Parameter in komplexen Matrizes,<br />
wie zum Beispiel Zucker im Blut [10,11] . Durch die feste Verankerung von Proteinen an<br />
Enzymoberflächen kann heute zum Beispiel die Glukosekonzentration im Blut von Diabetespatienten<br />
über solche auf Enzymelektroden basierenden Biosensoren zu erschwinglichen<br />
Preisen bestimmt werden [9,12,13] . Ebenso lassen sich Hormone, Antigene und Antikörper bestimmen<br />
[14] .<br />
Die Nachfrage nach solchen Systemen, die vor allem in der medizinischen Diagnostik sowohl<br />
ex vivo als auch in vivo Anwendung finden, wächst seit einiger Zeit stetig. Jedoch stellt<br />
die stabile und dauerhafte <strong>Immobilisierung</strong> unter Retention der biologischen und katalytischen<br />
Aktivität der Proteine eine große Herausforderung dar [7,15–17] . Bislang verfügbare Verfahren<br />
zur Oberflächenmodifikation stellen die Quervernetzung [18] , die kovalente Anbindung<br />
[10,19,20] oder der Membranschluss [21] dar. Der Nachteil dieser Verfahren ist, dass die Reproduzierbarkeit<br />
von Ergebnissen und Messwerten nicht immer gegeben ist.<br />
Ein weiteres Problem ergibt sich auch durch die fehlende Information über die Orientierung,<br />
mit der ein Enzym an die Oberflächen gebunden wird. Eine Bindung in einer ungünstigen<br />
Position kann den Zugang der Substrate zu den aktiven Zentren der Enzyme bzw. der<br />
Bindungsdomäne der Antikörper erschweren oder unmöglich machen. Zudem kann ein Enzym<br />
so gut in seiner Matrix verpackt sein, dass es nicht von der Oberfläche dissoziieren kann,<br />
aber auch kein anderes Molekül mehr zu ihm durchdringt. Daraus ergibt sich die zu überbrückenden<br />
Distanz zwischen den Redoxzentren des Enzyms und dem des Elektronenmediators,<br />
welcher die Elektronen zur Elektrode bringen soll, als eine weitere Schwierigkeit.<br />
Der Abstand zwischen zwei Redoxzentren ist nach der Marcus-Theorie [22] , neben der Potentialdifferenz<br />
und der Reorganisierungsenergie, der wichtigste Parameter, der das detektierbare<br />
Signal qualitativ und quantitativ bestimmt. Die elektrochemische Reaktion findet oft tief<br />
in dem Enzym eingebettet statt, so dass es für den Elektronenmediator wichtig ist, direkt in<br />
das aktive Zentrum zu diffundieren. Eine etablierte und gute Methode für viele Anwendungen<br />
ist die ungerichtete freie Diffusion solcher Mediatoren, die an der Oberfläche reduziert oder<br />
1